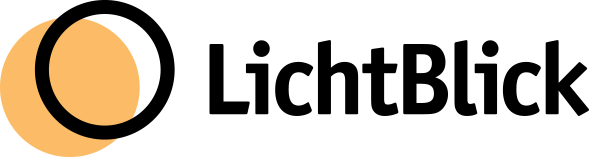Der Kolonialismus – das ist die Zeit gewesen, in der europäische Staaten wie Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich in verschiedenste Teile der Welt expandiert sind und dort Gebiete für sich beanspruchten. Und zwar, indem sie die Menschen, die dort lebten, unterdrückten, vertrieben und ermordeten. Mit der Unabhängigkeit der meisten dieser kolonisierten Staaten deklarieren viele das Ende der Kolonialzeit. Allerdings hat die dadurch entstandene Weltordnung viele Auswirkungen auf die Gesellschaft heute. Das spiegelt sich besonders in der Klimakrise wider.
Diejenigen, die den Klimawandel hervorgebracht haben, sind nicht diejenigen, die heute am meisten geschädigt werden. Das bedeutet, die Klimakrise ist auch eine koloniale Krise. Der ökologische Fußabdruck ist auch ein kolonialer Fußabdruck.
Joshua Kwesi Aikins, Politikwissenschaftler Uni Kassel
Klimakrise durch Ausbeutung und Sklaverei
Der Beginn des Klimawandels wird oft auf den Beginn der Industrialisierung datiert. Die hier geschaffenen Produktionsverhältnisse sind allerdings nur durch Sklaverei und Ausbeutung möglich gewesen. Beides ist auf den Kolonialismus zurückzuführen. Das bedeutet, dass die Staaten, die andere Gebiete kolonisierten auch eine besondere Verantwortung für die Folgen der Klimakrise haben.
Historically the so called rich nations, the industrialized nations have the major responsibility of this whole carbon emission and the crisis we have today. But they have very little interest in really owning up to that responsibility.
Tonny Nowshin | Klima- und Degrowth-Aktivistin
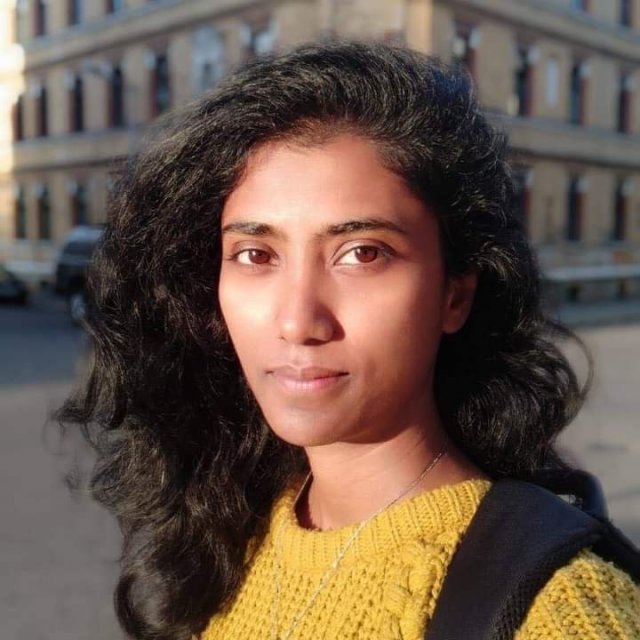 Foto: privat
Foto: privatHinzu kommt: Die Länder des globalen Nordens sind für mehr als zwei Drittel der historischen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Während die Menschen im globalen Süden bereits jetzt schon viel drastischer von den Folgen der Klimakrise betroffen sind.
Kolonialismus in der Klimapolitik
Bei Entscheidungen in der internationalen Klimapolitik haben die ehemals kolonisierten Staaten oft kein oder wenig Mitspracherecht. So entstehen Maßnahmen, die die Folgen des Klimawandels zwar abmildern sollen, zum Beispiel durch nachhaltige Energiegewinnung, dafür aber Ressourcen aus dem globalen Süden nutzen.
Es besteht die große Gefahr, dass es verstärkt zu einem grünen Kolonialismus kommt, also einem Zugriff von westlichen Staaten und Firmen auf Ressourcen im globalen Süden im Namen der Bekämpfung der Klimakrise, aber auf eine Art und Weise die koloniale Hierarchien verstärken.
Joshua Kwesi Aikins | Politikwissenschaftler Uni Kassel
In dieser Folge Mission Energiewende sprechen detektor.fm-Redakteurin Taiina Grünzig und Sophie Rauch darüber mit dem Politikwissenschaftler Joshua Kwesi Aikins. Er erklärt, wo genau sich Strukturen des Kolonialismus in der Klimapolitik fortsetzen. In welchem Zusammenhang der Begriff Umweltrassismus damit steht, das weiß Tonny Nowshin, Klima- und Degrowth-Aktivistin.
Alle Infos zur „BIPOC Climate Justice Conference“ findet ihr zum Beispiel hier.