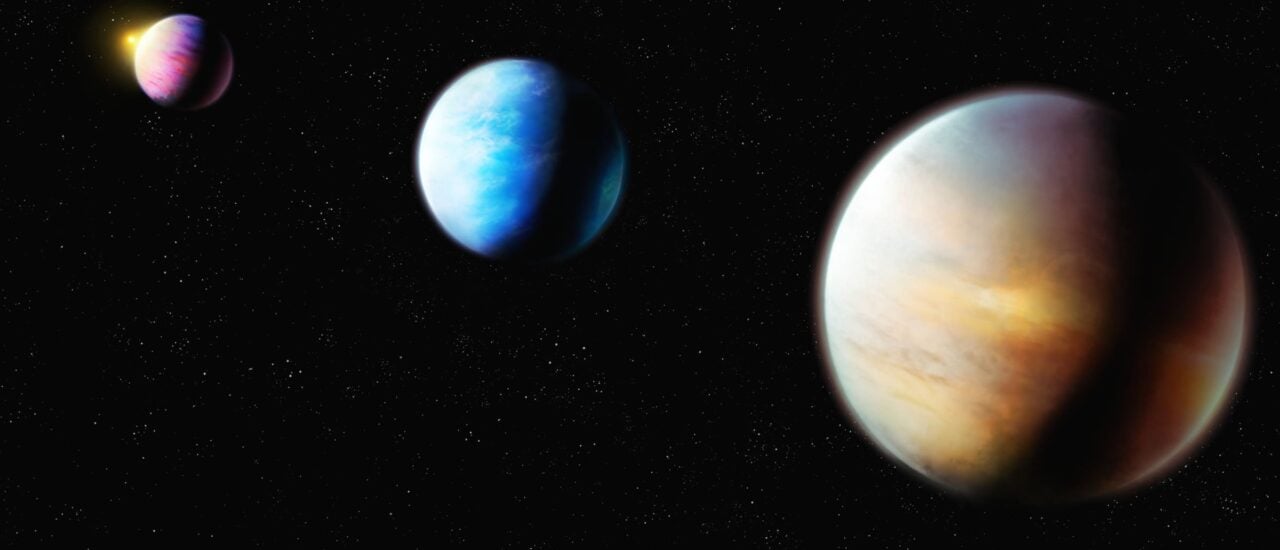Herbst 1889 in Paris. In einer großzügigen Wohnung im beliebten studentischen Wohnviertel Cartier Latin sitzt ein Mathematiker an seinem Schreibtisch. Von seiner hochschwangeren Frau und seiner zweijährigen Tochter im Nebenzimmer bekommt er kaum etwas mit. Denn seit Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren wird sein Leben von einem speziellen mathematischen Problem bestimmt. Er hat einen Fehler gemacht. In einer Arbeit, die dieses Problem ein für alle Mal lösen sollte, hat er einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Und er muss diesen Fehler korrigieren, sonst ist sein Ruf ruiniert und der seines guten Freundes gleich mit. Er muss das verhindern unbedingt. Das ist die Geschichte von Henri Poincaré. Untertitelung: Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Mathematik. Mein Name ist Caroline Breitschädel. Ich hoste diesen Podcast. Wie jeden zweiten Mittwoch werden Manon Demian und ich euch auch in dieser Folge eine Mathegeschichte erzählen und ein bisschen Mathematik erklären. In dieser Folge geht es um den französischen Mathematiker Henri Poincaré. Ein Name, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Poincaré zählt nämlich zu den bedeutendsten MathematikerInnen des 19. Jahrhunderts. Deshalb ist auch ein wichtiges französisches Institut für Mathematik nach ihm benannt: das Institut Henri Poincaré in Paris. Und das wiederum haben wir auch schon mal in einer unserer Folgen erwähnt. Der Mathematiker, Politiker und Wissenschaftskommunikator Cédric Villani war nämlich von 2009 bis 2017 Direktor dieses Instituts. Aber wofür ist Poincaré denn eigentlich berühmt geworden? Also ja, für seine Arbeit in der Mathematik und Physik, klar. Aber was hat er da auf den Weg gebracht? Um das zu beantworten, brauche ich natürlich, wie sollte es anders sein, Manon Bischoff, Mathe-Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Manon, sei gegrüßt! Hi! Caro! Also Manon, was erwartet uns heute an der Mathe-Front? Wir sprechen heute über ein super anschauliches Problem, nämlich das Dreikörperproblem, das einige vielleicht auch aus der Trisolaris-Trilogie kennen. Das ist eine Science Fiction-Buchreihe des chinesischen Schriftstellers Liu Sijie, die auch als Serie verfilmt wurde. Kann man als Three Body Problem bei Netflix anschauen. Uh, okay. Es klingt nach einem prominenten Problem, spannend. Aber worum geht es bei dem Dreikörperproblem denn? Da geht es darum, wie sich drei Massen durch den Raum bewegen, wenn die sich gegenseitig durch eine Kraft, die wie die Schwerkraft wirkt, anziehen. Okay, da kann ich mir jetzt noch nicht so gut vorstellen, wie man damit drei ganze Bücher füllen soll. Oh, glaub mir, das geht! Tatsächlich ist es eine meiner Lieblings-Science Fiction-Geschichten. Ich will aber auch noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht noch so viel: Beim Dreikörperproblem handelt es sich um eine klassische Frage aus der Himmelsmechanik. Und würde es jemand allgemein lösen, was bis jetzt noch nicht geschehen ist, könnte man den Bahnenverlauf von drei Himmelskörpern exakt vorhersagen, die sich, wie gesagt, gegenseitig anziehen. Das beschäftigt WissenschaftlerInnen schon seit Jahrhunderten. Okay, dann wollen wir uns mal anschauen, wie Henri Poincaré sich diesem Problem genähert hat und mit welchem Ergebnis. Denn ganz rund lief das ja offenbar nicht. Was da los war, darüber möchte ich mit Mathematiker Damien Nauwegoes sprechen, der glücklicherweise auch wieder mit dabei ist. Hi Damien! Hey Caro! Also Damien, ich hab es schon gesagt: Henri Poincaré ist kein Unbekannter. Im Gegenteil, er ist einer der ganz großen Namen der Mathematik und wird oft als das französische Pendant zum deutschen David Hilbert bezeichnet, der ja unter anderem Anfang des 20. Jahrhunderts in Göttingen total viel für die Mathematik tut. Ja, tatsächlich, es gibt durchaus Parallelen zwischen den beiden. Beide arbeiten in nahezu allen damals existierenden Gebieten der Mathematik. Beide widmen sich wichtigen mathematischen Grundfragen. Poincaré wird rückblickend oft auch als der letzte Universalgelehrte gepriesen. Denn er ist nicht nur ein brillanter Mathematiker, sondern auch ein anerkannter Physiker, Astronom und Philosoph. Dass Poincaré den Wissenschaften gegenüber so aufgeschlossen ist, sag ich mal, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Genau, er stammt aus einer einflussreichen Akademikerfamilie. Sein Vater ist z.B. Medizinprofessor an der Universität Nancy. Und ein Cousin von Henri Poincaré, Raymond Poincaré, ist sogar von 1913 bis 1920 Präsident von Frankreich, also unter anderem zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Okay, das ist ganz schön krasse Verwandtschaft. Was ist denn mit den weiblichen Familienmitgliedern? Also Poincarés Mutter kommt aus einer wohlhabenden Familie, so mit Landgut, wo er halt oft als Kind seine Ferien zusammen mit vielen anderen Verwandten verbringt. Seine Großmutter wohnt dort. Die soll im Kartenspielen und Rechnen unschlagbar gewesen sein. Ich stelle mir direkt vor, wie Henri und seine Oma in den Schulferien zusammensitzen und sie ihm so Rechenaufgaben stellt. So wie meine Uroma mir früher in den Ferien immer irgendwelche unsinnigen Reime beigebracht hat. Es klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich behüteten Kindheit bei Poincaré. Ja, klingt wirklich so. Er wächst behütet auf, geht aufs Gymnasium in Nancy, ist sehr gut in der Schule, außer in Kunst und Sport. Aber sonst überall, vor allem natürlich in Mathematik. 1868, also als er 14 Jahre alt ist, soll sein Lehrer bereits davon überzeugt gewesen sein, dass Poincaré mal ein großer Mathematiker wird. Poincaré selbst ist sich da allerdings noch gar nicht sicher. Das erfahren wir aus einer Biografie, die seine Schwester Aline später über ihn geschrieben hat. Ich kann mich auf nichts festlegen. Was weiß ich, was ich in 20 Jahren machen werde? Mit 14 noch nicht genau zu wissen, was man später mal werden will, finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich, muss ich sagen. Aber das Besondere bei Poincaré ist ja auch, er probiert total viel aus. Das stimmt, er nimmt z.B. auch Tanz- und Klavierunterricht und schauspielert. Und es wirkt so, als wolle Poincaré auch in allem wirklich gut sein. Z.B. kritzelt er in der Schule und später auch in der Uni oft seine Hefte mit kleinen Zeichnungen voll. Das machen ja viele, Gedanken verloren beim Zuhören. Aber von Poincaré ist z. B. ein Brief an seine Mutter überliefert, in dem er sich total darüber freut, dass er seine Zeichnenkünste verbessern konnte. Also dieses Rum-Skribbeln macht er wohl auch, um besser im Zeichnen zu werden. Und das Schöne ist, ein paar seiner Kritzeleien und Notizen sind wirklich auch erhalten. Da werden wir mal was in den Shownotes verlinken zum Anschauen. Es wirkt super spannend, wie Poincaré einerseits die Seiten voll kritzelt, aber auch gleichzeitig so wirklich gewissenhaft mitschreibt. Er scheint also sehr neugierig und sehr ehrgeizig und sorgfältig zu sein, aber auch ein bisschen zerstreut und super ungeduldig. So heißt z.B. auch eine lesenswerte Biografie über ihn: Henri Poincaré: Impatient Genius, also ungeduldiges Genie von Ferdinand Verhulst. Und wie äußert sich diese Ungeduld? Also anstatt den vernünftigen, vermeintlich längeren Weg zu gehen, vertraut er meistens lieber seiner Intuition und sucht nach Abkürzungen. Schon als Kind bei einem Spaziergang mit seiner Mutter und seiner Schwester durchquert er lieber kurzerhand einen Fluss, anstatt zur nächsten Brücke zu laufen. Das ist schon sehr bezeichnend für ihn. Auch in der Schule ist er super ungeduldig. Er fällt z.B. fast in seiner Mathe-Abiturprüfung durch, weil er nicht genug gelernt hat. Boah, ausgerechnet in Mathe, das tut bestimmt weh. Aber ich glaube, das ist eher so wie ein Denkzettel für ihn gewesen, weil er sich intensiv auf die Aufnahmeprüfung an den Pariser Elite-Unis vorbereitet. Als er sich dann dazu entscheidet: Okay, ich will jetzt ernsthaft Mathematik studieren. Und er wird tatsächlich auch an der École Polytechnique aufgenommen. 1873 beginnt er sein Mathematikstudium, forscht also ziemlich in allen mathematischen Teilgebieten und bereits sechs Jahre später promoviert er an der Universität zu Bonn. Er war wahrscheinlich einfach zu ungeduldig, um noch länger zu studieren. Aber er ist halt auch ein absolut genialer Wissenschaftler. Aber ich habe auch irgendwie so den Eindruck, er will innerhalb kürzester Zeit einfach möglichst viel mitnehmen, möglichst viel lernen und möglichst viel schaffen. Und das wird ihm halt irgendwann mal auch zum Verhängnis. Im Sommer 1885, da ist Poincaré 31 Jahre alt, da wird ein Mathematikwettbewerb ausgelobt. Alle wichtigen mathematischen Fachzeitschriften berichten davon. Die Ausschreibung kommt aus Schweden. Schirmherr ist der schwedische König Oskar II. Und Absender der schwedische Mathematiker und Freund von Poincaré, Magnus Gössl. Er hat die Idee für den Wettbewerb, unterschreibt Der Preis besteht aus einer Goldmedaille im Wert von 1000 Kronen und einem Geldbetrag in Höhe von 2500 Kronen. Das ist richtig viel Geld. Und dann wirken natürlich noch Ruhm und Ehre für den Gewinner. Denn der Siegerbeitrag wird außerdem in der Acta Mathematica veröffentlicht, einer renommierten mathematischen Fachzeitschrift. Wetter Kläffler hat sie selbst gegründet und ist auch Chefredakteur. Und Poincaré, der ist Feuer und Flamme. Und was muss er machen, um zu gewinnen? Der Wettbewerb besteht aus vier Einzelfragen, von denen man eine beantworten muss. Eine der Aufgaben behandelt das sogenannte N-Körper-Problem. Die Lösung könnte zu neuen Einsichten über die Stabilität des Sonnensystems führen. Und das ist die Aufgabe, die Poincaré auswählt. Und das, obwohl er schon zu einem der anderen Probleme wichtige Beiträge veröffentlicht hat. Aber ja, er will diese Aufgabe. Es ist eine sehr prestigeträchtige Fragestellung. Wie man auch schon gesagt hat, prüht Mathematica bereits seit Jahrhunderten über eine Lösung. Magst du nochmal sagen, worum sich die Aufgabe dreht? Also man betrachtet ein System aus beliebig vielen Teilchen, die sich gegenseitig anziehen, wie eben Planeten im Sonnensystem durch die Gravitation. Man nimmt an, dass diese Teilchen sich jetzt nie direkt berühren oder halt zusammenstoßen. Und unter dieser Annahme heißt es, müssen sich die Bewegungen der Teilchen bzw. die Bahnkurven der Planeten rechnerisch vorhersagen lassen. Diese Fragestellung hat, wie gesagt, eine lange Tradition. Startpunkt der Überlegung ist Newtons Principia von 1687, ein sehr berühmtes Werk über die mathematischen Grundlagen der Naturphilosophie. Darin präsentiert er seine Theorie der Gravitation. Und Mathematiker ahnen, damit müsste man doch auch die Bewegungen von Himmelskörpern berechnen können. Und es gibt auch Fortschritte über die Jahrhunderte. Für spezielle Fälle werden Lösungen gefunden. Aber eine allgemeine Formel, die findet niemand. Aber jetzt kommt ja Poincaré, hat als Ansporn noch 2500 Kronen und eine Goldmedaille vor Augen und macht sich ans Werk. Poincaré schreibt drauf los. Weil er so ungeduldig ist, blättert er nie zurück und schnell findet sich die Seiten. 158 werden es am Ende. Als einer der zwölf Teilnehmenden reicht Poincaré schließlich seinen Beitrag ein. Und die Jury ist schwer beeindruckt. Der Mathematiker Charles Hermit schreibt an seinen Jury-Kollegen Mitterkleffler: Poincarés Beitrag ist von so seltener Tiefe und Erfindungsgabe, dass er sicherlich eine neue wissenschaftliche Ära aus analytischer Sicht und für die Astronomie einleiten wird. Aber er schreibt auch weiter: Allerdings sind dazu noch sehr ausführliche Erklärungen erforderlich, und ich bitte den angesehenen Autor, mich über einige Punkte aufzuklären. Okay, also offenbar steckt schon viel Gutes drin, aber Poincaré muss wohl noch mal ran. Ja, genau, bevor die Arbeit in der Acta Mathematica veröffentlicht werden kann, muss sie vollständig und ausgereift sein. Also ergänzt Poincaré einige Erklärungen. Und dann noch weitere Nachfragen von Mitterkleffler und noch einige mehr. Und schließlich werden aus den 158 Seiten ganze 251. Der 21. Januar 1889 naht, und dann an seinem 60. Geburtstag verkündet König Oskar II. schließlich, dass Poincaré der Gewinner des Wettbewerbs ist. Und ganz Frankreich feiert seinen Vorzeigewissenschaftler Poincaré. Der kann jetzt endlich mal kurz aufatmen. Mal eben noch so knapp 100 Seiten im Paper ergänzen, das ist ja auch nicht ohne. Und Mitterkleffler ist bestimmt auch erleichtert, dass er jetzt endlich anfangen kann, die Veröffentlichung in der Acta Mathematica vorzubereiten. Im Oktober 1889 soll Poincarés Beitrag in der Acta Mathematica erscheinen. Edward Fragmin, ein Mitarbeiter von Mitterkleffler, geht die Arbeit also noch einmal durch und stockt an einer Stelle. Fragmin versteht nicht ganz, wie Poincaré auf bestimmte Schlussfolgerungen kommt. Anfang Juli 1889 schreibt er seinem Chefredakteur Mitterkleffler einen Brief und weist ihn auf die Unstimmigkeiten hin. Was ist denn da los? Schreibt Poincaré so unverständlich, oder sind seine Überlegungen einfach zu hoch für andere Mathematiker? Also Charles Hermit, der auch mit in der Wettbewerbsjury sitzt, findet Poincaré erscheine wie ein Prophet, für den die Wahrheit offensichtlich ist, aber eben nur für ihn. Das schreibt er in einem Brief an Mitterkleffler. Okay, das ungeduldige Genie halt. Ich stelle es mir aber ehrlich gesagt ganz schön anstrengend vor, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, wie jetzt zum Beispiel Fragmin und Mitterkleffler für die geplante Veröffentlichung. Werden die nicht auch langsam ungeduldig mit Poincaré? Also sie sind schon ziemlich verständnisvoll, gerade Mitterkleffler, der ja schon länger einen engen Briefkontakt zu Poincaré pflegt, aber steht natürlich auch selbst unter großem Druck. In diesem Spannungsfeld schreibt er Poincaré am 16. Juli 1889: Mein lieber Freund, Herr Fragmin hat mich gerade auf einige Passagen in Ihrer Dissertation zum Dreikörperproblem aufmerksam gemacht, die ihm etwas unklar erschienen und die er für erwähnenswert hielt. Er scheint aber auch Poincaré nicht viel Druck machen zu wollen. Meistens ist die Schwierigkeit nur scheinbar und kann fast sofort verschwinden, aber an der letzten von Herrn Fragmin erwähnten Stelle scheint mir eine echte Schwierigkeit zu bestehen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir erklären könnten, wie diese letzte Schwierigkeit überwunden werden kann. Poincaré ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ziemlich fertig, aber er macht sich erneut ans Werk und er merkt dann: Oh je, das sind tatsächlich ein paar seiner Schlussfolgerungen schlichtweg falsch. Oh Mist! Das muss echt super unangenehm sein. Er wird schon gefeiert dafür, dass er ein jahrhundertealtes Problem gelöst hat und dann, ja ups, doch nicht. Peinlich! Und die Zeit rennt ja auch. Eigentlich schon, aber Poincaré versucht natürlich, seinen Fehler zu beheben. Über Monate, nur er schafft es einfach nicht. Er braucht mehr Zeit. Also schreibt er im Dezember 1889, also fünf Monate später, einen Brief an Mitterkleffler: Ich habe Fragmin geschrieben, um Ihnen auf einen Fehler hinzuweisen, den ich gemacht habe. Doch die Folgen dieses Fehlers sind schwerwiegender, als ich zunächst dachte. Ich werde Ihnen nicht verheimlichen, wie sehr mich diese Entdeckung bedrückt hat. Ich weiß nicht, ob Sie denken, dass die verbleibenden Ergebnisse noch immer die großartige Auszeichnung verdienen, die sie Ihnen gegeben haben. Was für eine Katastrophe! Und nicht nur für Poincaré, sondern auch für Mitterkleffler. Es wäre ein Skandal, wenn in seinem angesehenen Journal eine fehlerhafte Beweisführung erscheinen würde. Und es kommt noch schlimmer, wie Poincaré von Mitterkleffler erfährt. Die Ausgabe der Acta Mathematica mit dem fehlerhaften Beitrag von Poincaré wurde bereits gedruckt. Und etwa 20 Kopien wurden bereits an Akademiker in Schweden verteilt. Oh shit! Das heißt womöglich, haben die Ersten schon seinen Fehler bemerkt. Und bald könnte sogar die ganze internationale Mathe-Community von diesem Fehler erfahren, wenn die Ausgabe erst mal im Umlauf ist. Mitterkleffler hat aber einen Vorschlag, um das Unheil abzuwenden. Poincaré kann die Kosten für eine Neuauflage übernehmen, in der die Fehler behoben werden. Und die ursprüngliche Auflage würde vernichtet werden. Aber der Druck der Neuauflage würde 3500 Kronen kosten, also 1000 mehr als das eigentliche Preisgeld. Das entspricht etwa dem halben Jahresgehalt eines Professors in Schweden. Autsch! Also entweder Poincaré blamiert sich vor der ganzen Mathe-Community, wenn alle erfahren, dass er einen dicken Fehler gemacht hat. Er, der Typ, der sich laut Hermit wie ein Mathe-Prophet benimmt. Oder er zahlt. Ja, was soll ich sagen? Poincaré akzeptiert das Angebot, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das ist wahrscheinlich auch Mitterkleffler ganz recht. Es wäre ja auch für ihn und seine Zeit extrem schädigend, wenn da ein fehlerhafter Beitrag erscheint. Und so gibt er nur seine Unabhängigkeit auf. Das darf eigentlich auch niemand erfahren. Ist wohl das kleinere Übel in diesem Fall. Also er lässt alle gedruckten Exemplare mit dem verschickten Kopien der Acta zurück. Einerseits natürlich, um sich selbst vor dem Skandal zu schützen. Andererseits aber auch, um Poincaré vor der Blamage zu bewahren. Okay, aber wie geht das jetzt aus? Poincaré hat immer wieder seinen Beitrag überarbeitet, zuletzt von Juli bis Dezember 1889, ohne eine Lösung für seinen Fehler zu finden. Dann will ich der einen 3500 Kronen für die Neuauflage mit der korrigierten Version zu zahlen. Aber zu dem Zeitpunkt hat er doch noch gar keine Lösung. Da hat er wahrscheinlich ein bisschen gepokert und sich gedacht, mit noch ein paar Monaten Zeit finde ich sicher schon einen Weg, um das auszubügeln. Und behält er recht? Naja, also es stellt sich heraus, dass eine klassische Lösung des Drei- Körper-Problems, wie von allen auch Poincaré angenommen, gar nicht existiert. Aber Poincaré findet bei seinen erneuten Berechnungen etwas vollkommen anderes, etwas komplett Neues heraus und fügt es seinem Paper hinzu. Und im Dezember 1890 erscheint dann endlich die Akte der Mathematiker mit Poincarés Beitrag, der nicht nur neue Überlegungen zum Drei-Körper-Problem enthält, sondern auch den Grundstein für ein ganz neues mathematisches Teilgebiet legt: die Chaos-Theorie. Mann, Mann, Mann, was für ein Hin und Her mit diesem Wettbewerb und dem Drei- Körper-Problem. Und was für ein Glück im Unglück Poincaré am Ende hat, dass er nicht für den Rest seiner wissenschaftlichen Karriere durch diesen Fehler gebranntmarkt ist und da mehr oder weniger zufällig eine krasse neue Entdeckung macht. Aber wie hängt es denn jetzt eigentlich alles miteinander zusammen? Also Gravitationsgesetz, Drei-Körper-Problem und Chaos-Theorie. Dazu spreche ich jetzt mit Manon. Und die Vorzeichen sind dieses Mal nicht schlecht. Manon, du hast zu Beginn der Folge schon gesagt, dass es heute ein anschauliches Problem ist. Und tatsächlich drei Planeten oder Sterne im Weltraum. Das kann ich mir erst mal ganz gut vorstellen. Ja, ich finde das Thema auch total cool, vor allem, weil ich ein großer Science-Fiction-Fan bin und die Trisolaris-Trilogie zu dem Thema echt empfehlen kann. Oder halt die Serie Three Body Problem. Die kannst du aus meiner Sicht nicht ganz mit den Büchern mithalten, ist aber auch ziemlich nice. Okay, die steht natürlich schon auf meiner Watchlist. Aber dann erzähl doch mal, natürlich ohne zu spoilern, bitte, worum geht’s denn da? Da geht es um eine außerirdische Zivilisation, die Trisolaria, deren Heimatplanet dem Untergang geweiht ist. Sie stammen nämlich aus einem fernen Sternensystem mit drei Sternen. Das ist also so, als hätten wir in unserem Sonnensystem drei Sonnen. Drei Sonnen, das klingt doch eigentlich erst mal ganz schön. Also mit Blick auf die Erderwärmung vielleicht nicht so praktisch, aber die Winter werden mit drei Sonnen vielleicht nicht ganz so dunkel. Das ist, finde ich, eine ganz reizvolle Vorstellung. Ja, das kann zunächst erst mal ganz schön klingen. Und tatsächlich gibt es im Universum sogar ziemlich viele Sternensysteme, die aus drei Sternen bestehen. Also das ist gar nicht mal so selten. Das Problem ist nur, die Bewegung der drei Sterne umeinander kann ziemlich kompliziert sein, weil jeder Stern seine eigenen individuellen Runden dreht. Oder warum meinst du? Ja, das auch. Aber die Sterne beeinflussen sich ja auch gegenseitig durch die Schwerkraft. Und sie bewegen sich herum. Und wie sich herausstellt, können die Flugbahnen super seltsame Formen annehmen, mit teilweise dramatischen Folgen für Trisolaria in der Science-Fiction-Geschichte. Die Gesellschaften auf dem dazugehörigen Planeten werden nämlich immer wieder ausgelöscht, wenn eine der Sonnen zu nah an ihnen heranreicht oder alle drei Sterne so weit entfernt sind, dass es eine zerstörerische Eiszeit gibt. Das klingt natürlich eher sehr ungemütlich, bzw. ja, richtig lebensfeindlich. Deshalb machen sich die Trisolaria in der Geschichte dann auch irgendwann auf die Suche nach einer neuen Heimat. Aber ich will jetzt erstmal nicht zu viel verraten. Was mich an den Büchern besonders gepackt hat, ist halt auch der VisCom-Aspekt. Denn tatsächlich erklärt der Autor die Physik des Dreikörper-Problems mit Betonung auf Problem ziemlich gut. Darin tauchen auch wichtige Mathematiker und Physiker auf. Okay, dann lass uns doch mal konkret werden. Was ist am Dreikörper-Problem so spannend, dass es Eingang findet in die Popkultur? To be fair, es sind wohl eher die Geschichten um das Dreikörper-Problem herum, die den Roman und der Serie zu dem Erfolg verholfen haben. Trotzdem aber ist die dazugehörige Wissenschaft echt faszinierend. Dafür müssen wir aber erstmal knapp 350 Jahre zurückreisen und zwar ins Jahr 1687, als Sir Isaac Newton seine Arbeiten zur Schwerkraft veröffentlicht. Newton ist ja auch ein alter Bekannter. Wir haben im Podcast über seinen Streit mit Leibniz gesprochen. Da ging es darum, wer zuerst die Grundlagen der Infinitesimalrechnung erfunden hat. Ja, damit haben Newton und Leibniz den Grundstein für die Analyse gelegt. Und mit dem newtonschen Gravitationsgesetz, also mit seinen Arbeiten zur Schwerkraft, begründet Newton dann auch noch die Mechanik. Da gibt es ja diese berühmte Geschichte, dass Newton einen Apfel auf den Kopf fällt und er so auf seine Ideen zur Gravitation kommt. Wahrscheinlich handelt es sich dabei nur um eine Legende, aber Newton ist der Erste, der erkennt, dass die Schwerkraft wahrscheinlich eine Folge von Masse ist. Also dass sich massive Objekte immer gegenseitig anziehen. Und nicht nur das. Newton schreibt auch die Formeln auf, mit denen sich die Kraft der Gravitation für verschiedene Objekte ausrechnen lässt. So kann er dann zum Beispiel berechnen, wie lange ein Apfel braucht, um vom Baum auf den Boden zu fallen, wenn er von der Masse der Erde angezogen wird. Oder auch, wie schnell sich die Erde um die Sonne bewegt. Also die Erde fällt ja wegen der Gravitation sozusagen auch um die Sonne herum, aber nur eben so schnell, dass sie nie hineinkracht. Das Besondere ist aber, die Erde zieht nicht nur die Dinge auf der Erde an, sodass alles nach unten, also Richtung Erdmittelpunkt, fällt, sondern auch auf die Sonne wirkt die Erdanziehungskraft. Nur eben viel geringer, weil die Sonne ja viel massereicher ist als die Erde. Auch das sagen die Gleichungen von Newton. Wenn man seine Gleichungen löst, dann kommt heraus, dass die Sonne auch ein bisschen wackelt, während die Erde um sie umrundet. Und Gleiches gilt auch für den Apfel. Auch er zieht die Erde leicht an, nur eben so minimal, dass es keinen wirklichen Effekt hat. Krass! Daran denke ich natürlich nicht, wenn ich hochspringe und durch die Schwerkraft wieder auf den Boden gezogen werde, dass ich dann auch eine klitzekleine Kraft auf die Erde ausübe. Dein Körpergewicht reicht aber auch noch lange nicht für einen merkbaren Effekt auf die Erde aus. Aber rein theoretisch ziehst du natürlich auch die Erde an. Und ich und Damian und alle unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir nämlich sehr anziehend sind, alle. Und all das lässt sich mit den Formeln von Newton ausrechnen, wenn man den Einfluss von zwei Massen aufeinander untersucht. Newton schaffte es damals, alle möglichen Bahnkurven von zwei Massen auszurechnen, die sich gegenseitig anziehen. Sein Ergebnis sind zum Beispiel die Ellipsenbahnen, wie die der Planeten unseres Sonnensystems. Oder auch Parabeln, wie von Asteroiden, die nur ganz kurz durch die Sonne abgelenkt werden und dann wieder wegfliegen. Du hast jetzt betont, all das berechnet Newton jeweils für nur zwei Massen. Also zum Beispiel Sonne und Erde oder Sonne und Venus oder aber Erde und Mond. Aber ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht? Also wie ist das, wenn wir jetzt Sonne, Erde und Mond zum Beispiel betrachten? Das sind ja dann drei Körper, die sich gegenseitig beeinflussen. Das hat Newton natürlich auch interessiert. Aber wie es sich herausstellt, lassen sich die Gravitationsgleichungen von Newton Für drei Körper lässt sich die Gravitationsgleichung nicht mehr exakt lösen. Okay, deshalb heißt es wohl „Drei-Körper-Problem“. Das ergibt Sinn. Aber was bedeutet das? Das heißt, du kannst zwar die Gleichung aufschreiben, aber es gibt keine exakte Lösung dazu. Also kannst du nicht für den allgemeinen Fall eine einzige Lösungsformel angeben. Somit können wir nicht ausrechnen, wie die Bahnkurven von Erde, Mond und Sonne jeweils aussehen. Die exakten Bahnkurven kennen wir nicht, aber wir können zumindest eine sehr, sehr, sehr gute Näherung berechnen. Und das reicht in der Praxis auch völlig aus. Für Erde, Mond und Sonne kann man zum Beispiel ausnutzen, dass die Sonne super viel schwerer ist als Mond und Erde. Wenn man das berücksichtigt, dann kann man die Formel von Newton vereinfachen und erhält dann eine leicht lösbare Formel. Und wie ist das, wenn es unter den drei Körpern nicht eine dominierende Masse wie die Sonne gibt? Auch dann gibt es manchmal Näherungsverfahren, je nach Ausgangslage und genauem Wert der Massen. Und es gibt sogar Spezialfälle, bei denen sich das Dreikörperproblem exakt lösen lässt. Es gibt zwar keine allgemeine Lösungsformel, aber für ganz bestimmte Konstellationen lässt sich die Flugbahn der Körper eben doch berechnen. Also, wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, oder wie wahrscheinlich sind diese Konstellationen? Also, so ein kleines bisschen realistischer sind die schon. Aber ja, eine erste theoretische Lösung für drei Körper findet der berühmte Mathematiker Leonhard Euler im Jahr 1767. Und zwar für drei Körper, die zu jedem Zeitpunkt eine gerade Linie bilden. Wenn zwei der drei Körper die gleiche Masse haben und man die dritte Masse bloß in der Mitte zwischen ihnen platziert, dann hat man schon ein System geschaffen, das diese gerade Anordnung immer beibehalten wird. So, was wurde im Universum aber noch nie beobachtet? Also ja, damit hast du wohl recht. Alles rein theoretisch, okay. Und einen weiteren wichtigen Fortschritt beim Dreikörperproblem macht dann Henri Poincaré. Demian hat ja schon erzählt, dass mit der Kleffler 1885 zu Ehren des 60. Geburtstags des schwedischen Königs einen Wettbewerb ausruft. 2500 schwedische Kronen für die Lösung von einer von vier Matheaufgaben. Und eine davon hängt mit dem Dreikörperproblem zusammen, oder genauer gesagt mit dem N-Körperproblem. Also es geht um eine Lösung für das Zusammenspiel von beliebig vielen, also N-Massen, die sich wegen der Gravitation gegenseitig anziehen. Klar, für drei Körper gibt es zwar keine genaue Lösung, aber hey, vielleicht ja für noch mehr Massen. Ja, das klingt erst mal vielleicht absurd, aber tatsächlich widerspricht sich das nicht. Mit der Kleffler weiß natürlich auch, dass die Gravitationsgleichung von drei oder mehr Massen keine allgemeine exakte Lösung haben. Er hofft aber, dass es zumindest eine allgemeine Näherungslösung gibt. Also er hofft, um genau zu sein, dass es eine unendlich lange Summe gibt, die das N-Körperproblem allgemein löst oder zumindest das Dreikörperproblem. Eine unendliche Summe als Lösung, also doch eine Lösung? Nicht im klassischen Sinne. Also eine richtige Lösungsformel, also ohne unendliche Summe, hast du zum Beispiel, wenn du an die Schule zurückdenkst und an quadratische Gleichungen wie 2 plus 3x plus 5 gleich 0. Die hat man gelöst, um zum Beispiel herauszufinden, an welchen Punkten eine Parabel die x-Achse schneidet. In diesem Fall kannst du immer die pq-Formel benutzen und die Lösung für x ausrechnen. Ah, warte! Für Momente wie diesen habe ich natürlich immer meinen kleinen Formelspickzettel zur Hand. pq-Formel: Pass auf, x ist gleich minus p halbe plus minus die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Korrekt, genau so habe ich es auch im Kopf. Und das ist eine klare endliche Formel. Also du kannst sie einfach in den Taschenrechner eintippen mit den entsprechenden Werten für p und q. Okay, wir haben hier also eine endliche allgemeine Lösungsformel, die jede quadratische Gleichung löst. Aber die gibt es ja für das Dreikörperproblem nicht, oder? Genau. Mitterkleffler hofft damals, dass es zumindest eine Lösungsformel gibt, die aus unendlich vielen Summanden besteht. Aber dann kannst du das ja unmöglich irgendwo eintippen. Du wirst immer irgendwann die Berechnung abbrechen und hast dementsprechend immer ein ungenaues Ergebnis. Deswegen ist es auch eine Näherungsformel. Aber die Hoffnung ist, dass die nachfolgenden Summanden, die du noch nicht eingetippt hast, insgesamt immer kleiner sind als das Ergebnis, das du erhalten hast. Sprich, je mehr Summanden wir mit einbeziehen, desto genauer wird dein Ergebnis und die Abweichung vom realen Wert wird immer kleiner. Auf eine solche unendliche Lösungssumme hofft Mitterkleffler. Und Poincaré glaubt, sie gefunden zu haben. Genau. Aber nicht für den allgemeinen Fall, sondern für einen Spezialfall des Dreikörperproblems, bei dem eine der drei Massen so klein ist, dass ihr Einfluss auf die anderen beiden quasi vernachlässigt werden kann. Und dann nehmen die Ereignisse, die Demian schon geschildert hat, ihren Lauf. Ja, die Lösung soll gedruckt werden. Doch dann bemerkt Poincaré einen Fehler in seiner Berechnung. Die Druckerpässe werden angehalten, die Arbeit muss nachgebessert werden, und dadurch macht Poincaré Verluste. 1000 Kronen muss er aus eigener Tasche drauflegen. Aber worin besteht denn sein Fehler, der ihm so teuer zu stehen kommt? Die unendliche Lösungssumme, die Poincaré findet, konvergiert nicht. Das heißt, die Summanden werden nicht immer kleiner. Es kann sein, dass der zwölfte Summand größer ist als der zehnte. Damit ist eine Näherung halt unmöglich. Wenn ich nach dem zehnten Summanden aufhöre, bin ich womöglich nicht mal ansatzweise in der Nähe eines realistischen Ergebnisses. Aber als Poincaré seinen Fehler untersucht, legt er den Grundstein für einen völlig neuen mathematischen Bereich: die Chaostheorie. Also, den Namen finde ich schon mal super. Oft wird der Name aber leider falsch verstanden. Chaos heißt in der Mathematik nämlich nicht, dass es überhaupt keine Regeln mehr gibt. Das Dreikörperproblem zum Beispiel ist chaotisch, aber die drei Massen unterliegen natürlich immer noch der Schwerkraft und folgen einer festgelegten Bahnkurve, die sich aus der gegenseitigen Anziehung ergibt. Aber kleinste Änderungen am System können enorme Auswirkungen haben. Verändert man zum Beispiel die Position eines Sterns in einem Dreikörpersystem um nur wenige Millimeter, können die Flugbahnen plötzlich völlig verschieden verlaufen. Krass, Millimeter machen schon so einen Unterschied. Es klingt nach Schmetterlingseffekt. Ja, tatsächlich stammt der Begriff aus der Chaostheorie. Also hat nicht nur das Dreikörperproblem, sondern auch die Chaostheorie den Weg in die Popkultur gefunden. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Film „Butterfly Effect“ von 2004. Ja, spannend. Aber du hast gerade gesagt, auch wenn sich Dreikörper chaotisch verhalten, folgen sie festgelegten Regeln und bewegen sich entlang einer eindeutigen Bahnkurve. Heißt das, dass sich eine Lösung doch zumindest rein theoretisch schon ausrechnen könnte? An sich schon. Oder zumindest eine Näherungslösung. Weil das Problem ist, du kannst ja unmöglich auf den Nanometer genau bestimmen, wo sich die Sterne befinden und welche exakte Geschwindigkeiten sie haben. Und selbst wenn du das könntest, es kann ja sein, dass sie durch ein Staubpartikel am Ende gestört werden und dadurch plötzlich völlig andere Flugbahnen entwickeln. Chaotische Systeme haben feste Regeln, aber in der Praxis lässt sich ihr Verhalten eben niemals über lange Zeiträume genau vorhersagen. Und das ist auch das Problem der Trisolaria, die auf einem Planeten leben, der sich um drei Sonnen bewegt. Genau. In der Geschichte versuchen sich die Trisolaria immer wieder auf bevorstehende Ereignisse vorzubereiten, zum Beispiel auf eine Eiszeit oder eine Hitzperiode. Aber wegen der unmöglichen Vorhersehbarkeit scheitern sie immer wieder. Ihre Gesellschaft wird immer wieder vernichtet. Und diesem Schicksal können sie wohl auch mit der ausgefeiltesten Mathematik nicht entfliehen, wenn ich dich richtig verstehe. Aber trotzdem ist das Dreikörperproblem bis heute ein aktives Forschungsgebiet. Immer wieder finden Forschende neue Beispiele für sogenannte gebundene Lösungen, die stabil sind. Also bei denen sich die drei Körper für immer auf einer stabilen Bahn bewegen, die durch kleine Störungen nicht wirklich beeinflusst wird. Ein Beispiel dafür sind drei gleiche Massen, die sich entlang eines Unendlichkeitssymbols, also einer liegenden Acht, bewegen. Ein solches Sternensystem wurde aber meines Wissens nach bisher auch noch nicht entdeckt. Aber wer weiß, welche wissenschaftlichen Entdeckungen wir zu unseren Lebzeiten noch mitbekommen werden. Manchmal kann es ja ganz plötzlich und unerwartet passieren, und dann gibt es durch einen Zufall auf einmal eine völlig neue Theorie. So geschehen ja bei Poincaré. Wobei Zufall wohl auch ein bisschen untertrieben ist, ich gebe es zu. Denn Poincaré hat das Dreikörperproblem ja auch erst jahrelang hin und her gewälzt, bevor seine Überlegungen dann irgendwann in der Chaos-Theorie gemündet sind. Es kann sich also durchaus lohnen, nicht zu früh aufzugeben. Und davon kann Demian auch ein Lied singen, sonst wäre er heute womöglich nicht Dr. Demian Aulgos. Ja, tatsächlich. Das stand für mich selbst in einem Moment auch kurz auf der Kippe. Ähnlich wie Poincaré, aber halt nicht so ganz dramatisch. Also das war bei mir nämlich so, dass ich meine Dissertation geschrieben habe und ein Jurymitglied einen Fehler gefunden hat, was natürlich unglaublich stressig war. Ich hatte ungefähr zwei Wochen Zeit, um das zu lösen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ansonsten wäre ein Kapitel von meiner ganzen Dissertation hin gewesen, aber ich konnte das Unheil abwenden. Ich konnte einen neuen Weg finden, um diesen Satz zu lösen. Und ja, es war gerettet. Demians Geschichte lehrt uns also auch, bei Hindernissen nicht sofort den Kopf in den Sand zu stecken. Und Poincarés Geschichte lehrt uns darüber hinaus, dass Irrtümer und Rückschläge auch nicht immer Niederlagen sein müssen. Manchmal sind sie auch der Anfang von neuen Erkenntnissen. Und mit diesem schönen Fazit möchte ich euch aus dieser Geschichte aus der Mathematik entlassen. Vielen Dank euch fürs Zuhören! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns doch gerne wissen. In einem Kommentar bei Spotify zum Beispiel, einer Bewertung bei Apple Podcasts oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Da erreicht ihr uns nun am besten unter podcast@spectrum.de. Und wenn ihr die ganze Geschichte von Poincaré und dem Dreikörperproblem nochmal nachlesen wollt, dann schaut mal in den Shownotes. Da habe ich euch Manons Spektrum-Kolumne verlinkt. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge. In der wird es wieder einige popkulturelle Referenzen geben. Also seid gespannt, schaltet wieder ein und bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio detektor.fm und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Naul Goos. Die Mathematik erklärt Hartmannon Bischoff. Die Redaktion und die Moderation habe ich übernommen: Carolin Breitschädel. In der Redaktion mitgeholfen haben Demian Naul Goos, Manon Bischoff und Ina Lebetjev. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Die Folge produziert hat Stanley Baldauf. Alle Folgen findet ihr auf detektor fm und spektrum.de. Untertitel der Amara.org Community.