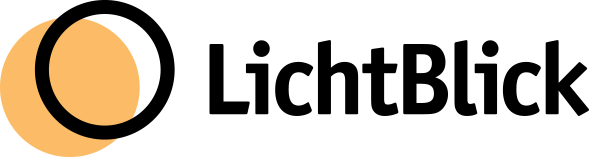Die wichtigsten und meisten Klimaschutzgesetze in Deutschland haben sich unsere PolitikerInnen nicht selbst ausgedacht. Sie kommen aus der EU. Viele Richtlinien und Verordnungen stammen aus dem Green Deal, etwa die Klimaneutralität bis 2050 und die verbindlichen CO2-Reduktionsziele für 2030. Der Green Deal soll Europa als ersten Kontinent der Welt klimaneutral machen. Es gibt ihn seit 2019, also seit sechs Jahren. Das Klimathema stand damals als zentrale Krise unserer Zeit im Zentrum des politischen Handelns. Heute ist das anders. Und heute ist auch das Europäische Parlament ein anderes. Jede bzw. jeder vierte Abgeordnete gehört einer rechtsextremen Fraktion an. Nie zuvor saßen so viele rechtsextreme PolitikerInnen im Europaparlament wie heute. Eines ihrer Ziele ist es, den Green Deal zu schwächen, schätzen BeobachterInnen ein. Wie sie das machen und welche Erfolge sie damit erzielen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ihr hört den Klima-Podcast von detektor.fm. Ich bin Ina Lebedjev. Mission Energiewende – Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostrom-Anbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 % Ökostrom. Noch nie gingen so viele Sitze im EU-Parlament an Rechtsextreme wie nach der Wahl im vergangenen Sommer. Jede bzw. jeder vierte Abgeordnete gehört einer der drei rechtsextremen Fraktionen an. Die größte sind die Patrioten für Europa, gefolgt von der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer und zu guter Letzt die neu gegründete Fraktion Europa der souveränen Nationen. Diese besteht zum größten Teil aus Abgeordneten der AfD. Sie alle haben es auf die Abschwächung und Abschaffung des Green Deals abgesehen, und sie feiern erste Erfolge. Welche das sind, das weiß meine Kollegin Julia Segers. Sie hat im Rahmen einer internationalen Recherche zur Klimapolitik der rechten Fraktionen im Parlament recherchiert. Hallo Julia. Hi. Das EU-Parlament arbeitet in dieser neuen Konstellation jetzt knapp ein Jahr zusammen. Du hast in den vergangenen Monaten viel Zeit damit verbracht, dir anzusehen, welche Rolle die AfD und ihre rechtsextremen KollegInnen aus anderen Ländern in der EU einnehmen, mit dem Augenmerk darauf, was diese neue Sitzverteilung im Parlament mit der Klimapolitik macht. Welche zentralen Erkenntnisse habt ihr aus der Recherche gewonnen? Also, wir haben uns in den vergangenen Monaten ziemlich viele Parlamentsreden angesehen, Social-Media-Profile durchforstet und Pressemitteilungen gelesen. Mit Hilfe von WissenschaftlerInnen konnten wir das Material dann auswerten, und dabei sind vor allem drei zentrale Erkenntnisse herausgekommen. Erstens: Die extreme Rechte im Parlament hat ihre Rhetorik in den vergangenen Jahren geändert. Anstatt den Klimawandel zu leugnen, setzen sie jetzt auf Verzögerungsstrategien. Das heißt, sie versuchen, gezielt Argumente zu bringen, die Ausreden für klimapolitische Maßnahmen finden. Und die verfangen ziemlich gut, auch bei Parteien außerhalb des rechten Randes. Und zweitens: Rechte Parteien schaffen es auf europäischer Ebene schon ziemlich gut, Einfluss zu nehmen und ihre Macht durch die neue Sitzverteilung auszuspielen. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie wichtige Aufgaben besetzen. Die rechtsextreme Gruppe Patrioten für Europa zum Beispiel, die wird die Verhandlungen über das EU-Klimaziel für 2040 leiten. Und auch die ersten Gesetze werden durch die Rechten in Mitleidenschaft gezogen. Und drittens: Es finden sich neue strategische Allianzen, die gegen die Klimapolitik der EU arbeiten. Das betrifft sowohl die Zusammenarbeit der drei rechtsextremen Gruppen im Parlament, aber auch die Zusammenarbeit mit der konservativen Fraktion Europäische Volkspartei, kurz EVP. Die sind die größte Fraktion im Parlament, vergleichbar mit der CDU auf Landesebene. Zur EVP gehört auch Ursula von der Leyen. Gemeinsam mit Parteien vom rechten Rand hat die EVP mehrere Umweltgesetze verschoben und verwässert. Man kann also sagen, die Brandmauer auf EU- Ebene bröckelt nicht nur, in ihr klaffen hier und da auch schon so ein paar Löcher. Der Green Deal ist gerade mal sechs Jahre alt. Die ersten Gesetze kamen mit dem Jahr 2019. Seit knapp einem Jahr arbeitet das neue Parlament, und schon werden Vorschriften entschärft. Wie konnte es so schnell dazu kommen, dass die EVP ihr eigenes Gesetzespaket jetzt scheinbar wieder auseinandernimmt? Das hat uns auch gewundert. Eine Wissenschaftlerin, die uns bei der Recherche Rede und Antwort gestanden hat, ist Catherine Fischi. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Rechtsextremismus am Robert Schumann Zentrum des Europäischen Hochschulinstituts. Fischi identifiziert mehrere sich selbst verstärkende Faktoren. Neben den Rechtsextremen hat auch die konservative Fraktion der EVP deutlich an Macht gewonnen, während die Grünen im Europaparlament ziemlich viele Sitze verloren haben. Außerdem ist die Position der Konservativen dadurch gestärkt worden, dass Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin wiedergewählt worden ist. Dazu kommen die Nachwirkungen der Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Weltpolitisch haben auch die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump und dessen Drill-Baby-Drill-Politik für eine Abkehr von ambitionierter Klimapolitik gesorgt. Und auch der politische Wandel in Deutschland, von der klimapolitisch ambitionierten Ampel zurück zur Großen Koalition unter der Führung von Merz, beeinflusst die Stimmung im EU-Parlament, erzählt Fischi. In der Merz-Koalition geht es meiner Meinung nach viel stärker um Industrialisierung und Re-Industrialisierung, sowie um den Schutz Deutschlands und deutscher Interessen. Dies geht auch Hand in Hand mit dem Schutz Europas und natürlich mit allen möglichen positiven Aspekten ihrer Haltung gegenüber der Ukraine. Ich denke jedoch, dass eine Partei wie die CDU, die besonders aufmerksam sein wird, damit direkt ins Zentrum der europäischen Machtstruktur rückt. Im Wesentlichen geht es darum, Dinge zu verzögern, zu verwässern, zu vereinfachen, wie auch immer man es euphemistisch bezeichnen mag. Sie werden dabei im Zentrum stehen. Ich denke, dass die Macht der CDU ein zweischneidiges Schwert ist. Sie hilft uns in einigen europäischen Fragen, aber ich glaube, dass sie den Green Deal schwächt und die Versuchung erhöht, Vereinbarungen mit Leuten wie beispielsweise der EKR und Georgia Meloni usw. zu treffen. EKR, das ist die rechte Partei der europäischen Konservativen und Reformer. Darin spielt vor allem die italienische rechtsextreme Partei der Ministerpräsidentin Georgia Meloni, Brothers of Italy, eine große Rolle. Catherine Fischi nennt diese Konstellation den aktuellen politischen Zeitgeist, einen perfekten Sturm, also eine Mischung aus Krisen, Machtverlagerung und politischem Opportunismus, die den Green Deal schwächt. Plötzlich liegen politische Deals zwischen Konservativen und extremen Rechten im Rahmen der Möglichkeiten. Damit das passieren kann, also damit diese Deals stattfinden können, müssen die Parteien ja zumindest ähnliche Ansichten und Ziele haben. Wie kommt es, dass sich die Rechten und die konservative Fraktion gerade beim Thema Klima so annähern? Seit 2019 sind ja einige Krisen zur Klimakrise dazugekommen, mit denen unsere PolitikerInnen zu tun haben. Das war erst das Ausbrechen und die wirtschaftlichen Nachwirkungen von der Corona-Pandemie. Dazu kam dann der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise. Das wiederum führt dazu, dass die Klimapolitik weniger stark priorisiert wird. William Lamp ist Klimaforscher am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit unter anderem mit klimapolitischen Analysen und beobachtet in den vergangenen zwei Jahren mehr und mehr Attacken auf klimapolitische Maßnahmen. Noch vor ein paar Jahren gab es große soziale Bewegungen wie Fridays for Future, die sehr aktiv waren und die das Klimathema im politischen Diskurs sehr gestärkt haben. Die Reaktion bestimmter Interessengruppen bestand darin, sich auf das zu konzentrieren, was ich als nicht transformative Lösung bezeichnen würde. Also, okay, wir sollten etwas tun, aber vielleicht sollten wir nur diese kleinen Dinge tun. Zum Beispiel sollten wir keine unterstützenden freiwilligen Maßnahmen ergreifen. Wir sollten Steuern vermeiden. Wir sollten vermeiden, uns zu sehr auf fossile Brennstoffe zu konzentrieren. Wir sollten natürlich Klimaziele haben, aber vielleicht nicht unbedingt eine ehrgeizige Agenda für die Politik. Wir haben einige Jahre Klimapolitik hinter uns, und ich denke, es ist für viele Interessengruppen verlockend, auf die ihrer Meinung nach negativen Entwicklungen hinzuweisen. Insgesamt würde ich also sagen, dass weniger über tatsächliche Lösungen diskutiert wird, also darüber, was wir tun sollten, sondern dass der Fokus eher darauf liegt, was alles schiefgelaufen ist und wir wirklich versuchen sollten, viele dieser Bemühungen rückgängig zu machen. Und diese Strategie, dieses Betonen der Nachteile von klimapolitischen Maßnahmen, das scheint zu verfangen, unter anderem eben auch bei möglichen Koalitionspartnern wie der konservativen Fraktion der EVP. Ihr wollt 100 Prozent Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass sich auch die Art und Weise, wie rechtsextreme Parteien über das Klima sprechen, verändert hat. Lange Zeit haben rechte Parteien versucht, den Klimawandel zu leugnen und so Argumente dafür zu finden, dass die Klimapolitik überflüssig ist. Wie ist es heute? Es gibt ein ziemlich großes Problem, das Klimawandelleugner heutzutage haben, nämlich dass die Beweise für den Klimawandel mittlerweile einfach überwältigend sind, sagt Klimaforscher William Lamp. Und auch, dass man den menschlichen Einfluss darauf nicht mehr leugnen kann. Das zeigen ja auch die IPCC-Berichte immer sehr eindrücklich, die alle vier bis fünf Jahre veröffentlicht werden. Und dazu kommen die Auswirkungen auf den Alltag der Menschen: Überflutungen, Brände, Trockenheit, Hitzewellen – das alles nimmt weltweit zu. Und das führt laut Lamp dazu, dass neue Argumente gefunden werden, sogenannte Verzögerungsargumente, die darauf abzielen, Maßnahmen gegen den Klimawandel aufzuschieben oder eben zu verwässern. Verzögerungstaktiken sind ein eher offener Raum. Fragen wie: Wie löst man das Problem des Klimawandels? Wie macht man gute Klimapolitik? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Es gibt viel Raum für Diskussionen, und diesen Raum kann man nutzen. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum diese Taktiken so effektiv sind. Man kann immer argumentieren: Ja, wir sollten etwas tun, aber vielleicht eher dies als das. Vielleicht sollten andere ein bisschen mehr tun als wir, oder vielleicht lohnen sich diese Bemühungen gar nicht wirklich. Es ist durchaus möglich und auch wichtig, diese Diskussion zu führen, um als Gesellschaft die beste Lösung zu finden, die für sie funktioniert. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Interessengruppen sich einschalten und dies ausnutzen können, um unsere Ambitionen zu dämpfen und uns zu Lösungen zu drängen, die vielleicht weniger effektiv sind, und so Argumente für eine Verzögerung des Klimaschutzes aufzubauen. Und diese Verzögerungstaktiken oder Argumente machen nicht halt am rechten Rand. Sie verfangen auch bei den Konservativen und ihren Wählern. Welche Argumente sind das denn? Hast du ein paar Beispiele parat? Also, Lamp und seine KollegInnen haben diese Argumente in einer Studie kategorisiert. Und die Seite klimafakten.de hat die Studie sehr ansehnlich in einem Poster aufbereitet. Wer sich das mal anschauen möchte, den Link dazu packe ich gerne in die Shownotes. Grundsätzlich kann man die Argumente in einem Poster aufbereiten und die Argumente in vier Kategorien einteilen. Erstens: Verantwortung weitergeben. Also nicht wir sollen was tun, sondern alle anderen zuerst. Ein Beispiel dazu kommt vom Bundeskanzler Friedrich Merz, denn vor kurzem hat er argumentiert, dass Deutschland nur für zwei Prozent aller Emissionen weltweit zuständig ist und China ja viel mehr CO2 ausstoßen würde als wir. Ja, das habe ich auch gesehen. Merz‘ Aussagen wurden unter anderem auch auf Social Media analysiert, kommentiert und so Faktenchecks unterzogen. Ja, genau. Und mit dem, was er da sagt, lenkt Merz die Verantwortung auf andere, in dem Fall auf China. Und er verschweigt, dass wir als erfolgreiche Industrienation ebenfalls eine ziemlich große Verantwortung haben. Sehr bekannt ist auch das Beispiel des CO2-Fußabdrucks. Der kommt zwar ursprünglich aus der Wissenschaft, wurde aber im Jahr 2004 vom Mineralölkonzern BP massiv gepusht, einer der größten Ölkonzerne und damit Verschmutzer der Atmosphäre überhaupt. Und mit einer sehr erfolgreichen Kampagne lenkt das Unternehmen damals ebenfalls von der eigenen Verantwortung ab und schiebt sie den VerbraucherInnen zu, indem diese ihren eigenen kleinen Einfluss mithilfe des CO2-Fußabdrucks berechnen sollen. So ändern bestimmt einzelne VerbraucherInnen ihren Lebensstil, was ja auch gut und wichtig ist. Aber BP macht als großer Verschmutzer eben einfach weiter wie bisher. Die Argumente kommen also nicht nur von der Politik, sondern auch von der Öl- und Gaslobby. Das wird auf jeden Fall vermutet. Es ist nicht immer so offensichtlich wie im BP-Fall und dem individuellen ökologischen Fußabdruck. Für eine weitere Kategorie ist die FDP in Deutschland ein ganz gutes Beispiel. Da geht es darum, zu schwache Maßnahmen zu propagieren, etwa teure E-Fuels, obwohl wir im Verkehrssektor ziemlich einfach auf elektrische Motoren umsteigen könnten. Die FDP hat da ja immer auf die berühmte Technologieoffenheit gepocht. Und dazu sagt William Lamp: Einige Technologien sind wahrscheinlich vielversprechender als andere. Wasserstoff scheint für den Verkehrs- oder Heizungssektor keine vielversprechende Option zu sein. Es gibt zwar potenzielle Anwendungsfälle für die Schwerindustrie, aber aus technologisch-ökonomischen Studien wissen wir, dass es unglaublich teuer und unglaublich schwierig sein wird, eine ausreichende Versorgung aufzubauen, um die Emissionen im Verkehrs- oder Heizungssektor nennenswert zu senken. Das Schöne für Interessengruppen, die diese Art von Narrativ vorantreiben, ist, dass es Verbrennungsmotoren auf dem Tisch hält. Wenn man also seine Optionen für Wasserstoff als Kraftstoff in den beiden Sektoren Heizung und Verkehr offenhalten will, dann hält man die Verbrennung von Kraftstoffen auf dem Tisch. In dem Zuge können wir dann eine Diskussion darüber führen, dass es vielleicht kein 100-prozentig grüner Wasserstoff ist, sondern blauer Wasserstoff. Es könnte Wasserstoff sein, der auf Erdgas in der Lieferkette basiert. Erdgas in der Lieferkette, damit haben Sie wieder fossile Brennstoffe. Ich bin ein wenig misstrauisch gegenüber solchen Diskursen, weil aus den uns vorliegenden Wirtschaftsstudien ziemlich klar hervorgeht, wo der Anwendungsverlieg und wo nicht. Ich habe das Gefühl, dass dies wahrscheinlich ein Versuch ist, die aktuelle Politik in diesen Bereichen zu untergraben. Die Fakten liegen also auf dem Tisch, sagt die Wissenschaft. Es gibt sinnvollere Maßnahmen, aber einige PolitikerInnen entscheiden sich trotzdem dafür, aus welchen Gründen auch immer, diese schwachen Maßnahmen zu propagieren. Dazu gehört auch das Argument, dass Verbote nichts bringen, sondern freiwillige Anreize bevorzugt werden sollen, weil Vorschriften und Regeln die Leute nur verschrecken würden. Das geht dann so weit, dass die Grünen-Fraktion auf EU- Ebene ganz prominent in der letzten deutschen Legislatur die Grüne Partei als Verbotspartei bezeichnet wurde, besonders aus der rechten Ecke, aber eben auch von konservativen PolitikerInnen. Ich habe mitgeschrieben, wir haben bisher zwei von vier Kategorien: die erstens Verantwortung weitergeben und zweitens zu schwache Maßnahmen propagieren. Was gibt es da noch? Die dritte Kategorie fasst Argumente zusammen, die die Nachteile betonen, etwa dass Klimaschutzmaßnahmen die Armen noch ärmer machen. Und gerne genutzt wird hier das Beispiel der armen Krankenschwester, die sich bald das Auto oder den Urlaubsflug nach Mallorca nicht mehr leisten könne. Und auch Perfektionismus gehört zu dieser Kategorie, also die Suche nach der einen Lösung, die die Klimakrise alleine lösen kann. Bei der AfD sehr beliebt ist auch das sogenannte Fortschrittsversprechen, also das Argument, dass nur fossile Energieträger unseren Wohlstand vergrößern und erhalten können. Ich habe dir hier mal ein Beispiel aus einer Parlamentsrede mitgebracht. Die kommt von René Aust, dem Co-Vorsitzenden der ESN-Fraktion im EU-Parlament und Mitglied der deutschen AfD: „Die deutsche Industrie zahlt für Energie und insbesondere Strom erheblich mehr als die Industrie in anderen großen Nationen wie den USA oder China. Auch deshalb stehen aktuell in Duisburg, Salzgitter oder auch Eisenhüttenstadt tausende Arbeitsplätze vor dem Aus. Die Stahlindustrie wird von der Politik der Europäischen Union und der Bundesregierung in Deutschland in die Existenzkrise gestoßen. Es braucht darum jetzt einen Kurswechsel. Nein zum Green Deal, nein zur künstlichen Erhöhung der Energiepreise, ja zu modernen Kernkraftwerken und ja zur gewachsenen Industriestruktur und Industriekultur.“ Ja, der Kern des Arguments hier ist, der Green Deal und Klimapolitik generell schaden der Wirtschaft. Dieses Argument und der Verweis auf China, die USA und andere Länder, die viel CO2 emittieren, sind Argumente, die in ziemlich vielen AfD-Reden im Parlament zu hören sind. Dabei verschweigen sie die Kosten, die für die Gesellschaft entstehen, wenn wir gar nichts gegen die Klimakrise tun. Argumente aus der vierten Kategorie nutzt zumindest die AfD dagegen nicht. Die Kategorie nennen die WissenschaftlerInnen „vorschnell kapitulieren“. Dazu gehören Argumente, die Untergangshysterien in den Mittelpunkt stellen. Also sagen wir, wir können eh nichts mehr gegen den Klimawandel unternehmen, oder Argumente, die aussagen, dass Veränderung unmöglich ist und gegen die menschliche Lebensweise gehen. Ich glaube, die AfD bleibt hier so still, weil sie innerhalb der EU fast die einzige Partei sind, die den menschengemachten Klimawandel in Teilen immer noch leugnet. Und das passt mit diesen Untergangshysterie-Argumenten eben nicht zusammen. Also, du siehst, es ist ein buntes Potpourri, aus dem sich die Gegner und Skeptiker von Klimapolitik bedienen. Vergangenen Monat hatten wir hier im Klima-Podcast eine Folge zu der Frage, wie eigentlich Klimawandel-Leugnung entsteht, also wie es kommt, dass die Nachbarin im Hausflur immer öfter mit seltsamen Argumenten auffällt oder dass das Gespräch auf dem Grillfest plötzlich in eine seltsame Diskussion abdriftet. Und ich habe dafür mit WissenschaftlerInnen vom Institut für Meteorologie an der Universität Leipzig gesprochen, die dazu eine Vorlesung machen für ihre Studierenden. Es gibt nämlich Tools und Taktiken, die helfen, Klimawandel-Leugnung zu erkennen. Wie die aussehen, das könnt ihr euch anhören. Wir verlinken die Folge natürlich in den Shownotes. Das große Problem mit diesen Klimaschutz-Ausreden in der Politik ist, dass sie ziemlich gut funktionieren, denn es steckt ja oft ein Körnchen Wahrheit in ihnen. Außerdem werden ähnliche Argumente auch ohne die Absicht vorgebracht, Klimapolitik generell zu verhindern. Denn es ist ja zum Beispiel tatsächlich oft eine große Herausforderung, den Kosten der ökologischen Transformation gerecht zu werden. Nicht jeder Einwand zu Klimaschutzmaßnahmen ist deshalb automatisch eine Klimaschutz-Ausrede. Aber jeder legitime Einwand kann dann zu einer Klimaschutz-Ausrede werden, wenn er ausschließlich dafür genutzt wird, Klimaschutzmaßnahmen abzuwehren, ohne andere Möglichkeiten zu finden. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, eine Klimaschutz-Ausrede auch als solche zu erkennen. Ja, grundsätzlich kann man sagen, wenn nur von Problemen und nicht von möglichen Lösungen gesprochen wird, dann ist das schon ein guter Hinweis darauf, dass man es mit einer Klimaschutz-Ausrede zu tun haben könnte. Klar ist, Klimaschutz-Ausreden können häufig erst mal sehr überzeugend wirken, eben weil sie meistens auf legitimen Sorgen und auf realen Konflikten basieren. Und je ernster die Dekarbonisierung in der Wirtschaft in Angriff genommen wird, desto sichtbarer werden diese Sorgen und Konflikte auch. Wenn aber die legitimen Bedenken dazu benutzt werden, um konkrete Klimaschutzprojekte zu sabotieren, anstatt konstruktive Lösungen zu suchen, dann ist das ein Problem. Und genau das sehen wir gerade auf EU- Ebene am Beispiel des Green Deals. An welchen Stellen setzen die Rechtsextremen denn an? Was sind konkrete Beispiele dafür, wie der Green Deal geschwächt wird? Der erste große Meilenstein für die Parteien vom rechten Rand war die Verschiebung der Entwaldungsverordnung. Darin sind eine Reihe von Vorschriften zusammengefasst, die Unternehmen befolgen müssen, die Rohstoffe nach Europa importieren. Ziel der Verordnung ist, Wälder zu schützen. Und das sagt ja auch schon ihr Name. Für viele Produkte wie zum Beispiel Palmöl und Fleisch werden Regenwälder abgeholzt. Unternehmen sollten bestimmte Sorgfaltspflichten auferlegt werden, um das zu verhindern. Ursprünglich sollte die Verordnung Ende 2024 in Kraft treten. Der Anwendungsstaat ist aber um ein Jahr verschoben worden. Und das ist auch das erste Mal in der EU-Geschichte, dass eine wichtige Umweltentscheidung mit der Unterstützung von rechten Gruppen verabschiedet worden ist. Die konservative EVP hat sich nämlich bei denen die Mehrheiten geholt, die sie für diese Entscheidung gebraucht hat. Ja, und im April dieses Jahres ist das wieder passiert. Diesmal sind die Termine für die Umsetzung von zwei wegweisenden Gesetzen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verschoben worden. Und im Juni hat eine Schmutzkampagne der rechten Parteien gegen Umwelt-NGOs ziemlich weite Kreise gezogen. Die Behauptung ist, dass die EU angeblich Umwelt-NGOs dafür bezahlen würde, dass sie sich für den Erhalt des Green Deals einsetzen. Dafür gibt es aber keine Beweise. Trotzdem wird es immer wieder im Parlament und in den Medien thematisiert. Solche Schmutzkampagnen gegen die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft sind neben den Klimawandelausreden eine weitere Strategie, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu verhindern, beobachtet William Lamp. Wenn ich über die übergeordneten Strategien nachdenke, die eingesetzt werden, um Klimapolitik zu bekämpfen und Maßnahmen gegen den Klimawandel zu verhindern, dann sind das Klimaskepsis und die Skepsis gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels. Die Idee, dass der Klimawandel gar nicht so schlimm sein wird, ist Klimaverzögerung. Also die Maßnahmen werden nicht funktionieren, sie haben Probleme und so weiter. Und dann gibt es auch noch die persönlichen Angriffe, also Angriffe auf Wissenschaftler, Angriffe auf Befürworter der Klimapolitik, darunter NGOs, politische Entscheidungsträger und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Wissenschaftler sind mit diesem Problem sehr direkt konfrontiert. Ich habe Kollegen, die persönlich angegriffen wurden, um ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit zu untergraben. Aber ich weiß, dass es diese persönlichen Angriffe auch auf viele Menschen in der Gemeinschaft gegeben hat. Ich denke also, dass dies sicherlich ein Teil der Verzögerungstaktiken ist. Das sieht man ja auch an krassen Anfeindungen gegen zentrale AkteurInnen wie etwa Robert Habeck, Luisa Neubauer oder Greta Thunberg. Aber eben auch auf die Wissenschaft, einzelne progressive PolitikerInnen und NGOs im Allgemeinen. Ziel dieser Strategien ist es, das Verhalten und die politischen Präferenzen von Menschen zu beeinflussen und somit Politik zu bestimmen. Was bedeutet das denn alles für die Zukunft der Öffentlichkeit? Für die Zukunft des Green Deals steht das ganze Paket und damit auch der Klimaschutz in Europa auf der Kippe. Es gibt Stimmen aus der Wissenschaft, die das befürchten. Aber die Politologin Catherine Fischi ist da optimistischer. Sie meint: „Ich bin der Meinung, dass der Green Deal auf europäischer Ebene nicht vollständig rückgängig gemacht werden kann. Ich glaube nicht, dass jemand wie Trump kommen und so weit zurückrudern wird. Ich denke, dass europäische Unternehmen massiv investiert haben. Nicht nur massiv in bestimmte Technologien, sondern auch massiv in Compliance. Und sie haben massiv in eine Art vorausschauende Prognose investiert, was ihre eigenen strategischen Pläne angeht. Wenn wir uns hingegen anschauen, was in den einzelnen Parlamenten vor sich geht, sehen wir, dass insbesondere Frankreich unter dem Druck der Extremrechten die größte Einzelpartei ist. Und der konservativ-rechten Partei einige ernsthafte Argumente für eine Klimapolitik-Verzögerung gibt. Und im Zusammenhang mit dem Klima kann eine Verzögerung in bestimmten Bereichen viel mehr als nur eine Verzögerung bedeuten. Es kann bedeuten, dass man eine wichtige Chance verpasst, etwas zu tun. Einige meiner Bekannten bei den Grünen und der liberalen Fraktion in Brüssel glauben, dass dies das Ende des Green Deals ist. Der Meinung bin ich nicht. Aber ich glaube, dass wir uns in einer Phase echter Verzögerung und Verwässerung von klimapolitischen Maßnahmen befinden. Und ich sehe keine sofortige Besserung. Wie kann man es denn schaffen, diesen Klimaschutz-Ausreden zu begegnen? Was können WissenschaftlerInnen, AktivistInnen und politische EntscheidungsträgerInnen machen? Und wie kann ich bei der nächsten Familienfeier dafür sorgen, dass diese Argumente nicht in meinem persönlichen Umfeld verfangen? Das ist ein bisschen ähnlich dazu, wie es mit dem Eindämmen der Corona-Pandemie war. Wir müssen quasi gegen diese Ausreden geimpft werden. Das zeigen Erkenntnisse aus der Forschung zur Wirksamkeit von Klimaleugnungen. Forschungsergebnisse deuten nämlich darauf hin, dass eine präventive Aufklärung über die Hintergründe von Klimaschutz-Ausreden helfen kann, deren Wirkung zu bekämpfen. Also genau sowas wie zum Beispiel die Vorlesungen zum Thema am Institut für Meteorologie an der Universität Leipzig. Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel. Und wichtig ist, dass diese Argumentationsmuster auch in der Öffentlichkeit oder eben am Familienfeiertisch thematisiert werden. Die öffentliche Debatte muss also gestärkt werden, indem wir über Klimaschutzmaßnahmen sprechen und sie auch diskutieren. Und ganz wichtig: Wir müssen auch aufzeigen, dass ein effektiver Klimaschutz möglich ist und sozialgerecht umgesetzt werden kann. Wenn du eure Recherche nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen, wäre der Kerngedanke eurer Erkenntnisse? Der Kerngedanke wäre, dass Klimaschutz-Ausreden den Green Deal auf europäischer Ebene schwächen und dafür sorgen, dass Gesetze abgeschwächt werden. Die Machtverschiebung nach rechts sorgt für neue Allianzen in der EU, in der auch die AfD einen Platz gefunden hat. Autorin und Reporterin Julia Segers hat gemeinsam mit Kollegen aus der EU zu der Frage recherchiert, wie Rechtsextreme im EU-Parlament den Green Deal schwächen. Unterstützt worden ist diese Recherche von Journalism Fund EU. Vielen Dank, dass du eure Ergebnisse mit uns geteilt hast, Julia. Sehr gerne, danke für das Gespräch. Wenn ihr mehr wissen wollt zu Klimaschutz-Ausreden, dann besucht gerne mal die Seite klimafakten.de. Da findet ihr ein Quiz zu den verschiedenen Kategorien und könnt testen, ob ihr die Ausreden durchschaut. Wir verlinken euch die Seite in den Shownotes. Da findet ihr auch die gesamte Recherche von Julia und ihren Kollegen, die als englischsprachiger Artikel von DSMOK veröffentlicht wurde. Der Klimapodcast von detektor.fm ist nächste Woche wieder am Start. Keine Ausrede für die Audio-Produktion dieser Folge hatte Tim Schmutzler. Und die Redaktion hatte ich, Ina Lebedjev. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald hoffentlich. Ciao. Mission Energiewende – Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 % Ökostrom.