Ein dicker Bauch, das ist mehr als ein kosmetisches Problem. Es kann nämlich Herz, Leber und auch das Immunsystem gefährden. Das Stichwort ist viscerales Fett. Was es so gefährlich macht und was dagegen hilft, darum geht es heute bei uns im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Max Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm. Unser heutiges Thema betrifft uns irgendwie alle, denn bei den einen ist es etwas sichtbarer, bei den anderen vielleicht auch gar nicht. Es geht um das Thema Bauchfett, genauer gesagt das sogenannte viscerale Fett. Da muss man nämlich unterscheiden. Dieses viscerale Fett sammelt sich tief im Bauchraum an, also zwischen unseren Organen, und ist auf den ersten Blick harmlos. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie so ein warmes Polster um Magen, Leber und Darm herum. Aber die Forschung zeigt jetzt immer deutlicher, genau dieses viscerale Fett kann zu einer echten Gesundheitsgefahr werden, und immer mehr Menschen sind auch davon betroffen. Was genau dieses viscerale Fett so gefährlich macht, warum manche Menschen anfälliger dafür sind als andere und wie man das Ganze wieder loswird, darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit Frank Schubert. Der ist Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Frank. Hallo Max. Ja Frank, erstmal, was genau ist denn dieses viscerale Fett? Das ist ein Fettdepot im Unterleib, was sich zwischen den Organen befindet. Es umhüllt innere Organe wie den Magen, den Darm, die Leber, die Bauchspeicheldrüse und die Nieren. Und das brauchen wir. Das ist von unserem Körper unentbehrlich, weil es unsere Organe mit Energie versorgt und sie auch schützt vor Stößen und anderen Kraftentwirkungen. Naja, und man bezeichnet es als viscerales Fett, weil es die Eingeweide, also die Viscera, umkleidet. Also der Begriff kommt einfach vom Organ, quasi das Kleid fürs Organ, sozusagen. So, und du hast auch gerade schon gesagt, wir haben das alle. Es kommt nur quasi, wie oft, dann eben auf die Menge an oder auf die Dosis. Genau. Woher weiß ich denn jetzt, wenn ich mir meinen Bauch anschaue, um welche Art von Fett es sich handelt? Das ist nicht einfach zu sagen, weil von außen kann man das natürlich schlecht unterscheiden. Also man kann es schlecht unterscheiden vom Unterhautfett. Es ist weniger auffällig als das Unterhautfett, kann man, glaube ich, sagen. Auch wenn die beiden von außen nicht immer leicht zu unterscheiden sind. Also so ein typisches Zeichen für üppiges viscerales Fett ist der sogenannte Apfeltyp. Das ist, wenn man so einen runden Bauch, aber schlanke Gliedmaßen hat. Das ist relativ typisch für Männer. Das sieht man sehr oft bei korpulenten Männern. Der andere Typ ist der sogenannte Birnentyp. Das ist bei üppigem Unterhautfett, sieht man eher bei Frauen. Birnentyp ist, wenn es so üppige Rundungen an Hüften, an Oberschenkeln und an Gesäßen gibt. Und man kann sich als Faustregel merken: Ein erhöhter Bauchumfang oberhalb einer gewissen Grenze deutet auf erhöhte Mengen von visceralem Fett hin. Und als problematisch gelten 102 cm Bauchumfang bei Männern und 88 cm bei Frauen. Okay, und wenn ich mir jetzt dieses viscerale Fett anschaue, du hast es ja unterschieden zu diesem Unterhautfett, was man jetzt so als, ich nenne es jetzt mal normales Fett. Was macht dieses viscerale Fett denn nun gefährlicher als das andere? Und was für Folgen kann es vielleicht auch haben, wenn man zu viel davon hat? Ja, dieses viscerale Fett, das baut sich relativ schnell auf und auch schnell wieder ab. Und das führt dazu, dass es doch verstärkt dafür sorgt, dass die Blutfettspiegel erhöht sind und dass auch das Arteriosklerose-Risiko, also das Gefäßverkalkungsrisiko, erhöht ist. Deswegen ist es problematischer als das Unterhautfett, weil es sich eben schneller mobilisieren lässt und schneller mobilisiert wird im Körper. Die Fettzellen des Bauchfetts stehen in einem regen Informationsaustausch mit anderen Organen. Die setzen diverse Signalmoleküle, diverse Signalstoffe frei. Darunter sind Signalstoffe namens Cytokine, die fördern Entzündungen, unter anderem. Die hemmen auch die Freisetzung einer Substanz namens Adiponektin. Diese Substanz oder diese Hemmung führt dazu, dass die Insulinempfindlichkeit unseres Körpers heruntergeregelt wird, was sozusagen die Diabetesneigung verstärkt und was den Körper so ein bisschen in Richtung metabolisches Syndrom schiebt. Also metabolisches Syndrom nennt man ja die Kombination aus erhöhten Blutzuckerspiegeln, aus gestörtem Fettstoffwechsel, aus Bluthochdruck und starkem Übergewicht. Und das Ganze wird eben wahrscheinlicher, wenn solche Signalstoffe freigesetzt werden vom Bauchfett. Diabetes Typ 2 wird wahrscheinlicher, das Diabetes Typ 2 Risiko steigt und auch das Risiko für die koronare Herzkrankheit. Viszerales Fett entzündet sich relativ leicht, weil eben diese Signalstoffe auch entzündungsfördernd sind. Und das kann dann zu einer sogenannten Fibrose auch führen, also zu so einer Vernarbung des Fettgewebes, was dann wiederum zur Folge hat, dass sich das Fett nicht mehr richtig mobilisieren lässt. Genau, also aus all diesen Gründen ist eben dieses viszerale Fett problematisch. Und wie entsteht das jetzt genau? Also was sind die Ursachen dafür? Na ja, ganz wichtig für die Entstehung von Fettdepots ist natürlich erstmal der Energiehaushalt des Körpers. Also wenn die Energiezufuhr immer wieder den Energieumsatz des Körpers übertrifft, dann hat man sozusagen einen Plus und dann droht Übergewicht. Und besonders schwierig in dem Zusammenhang oder besonders problematisch ist halt natürlich die hochkalorische Ernährung, die wir eben in den westlichen Ländern leider eben ein sehr hohes Angebot davon haben, die eben sehr oft angeboten wird. Und hochkalorische Ernährung, also sehr kalorienreiche Ernährung, ist eben besonders schwierig in Verbindung mit Bewegungsmangel. Zu hochkalorischer Ernährung gehören hochverarbeitete Lebensmittel, die eben sehr reich an Zucker und an Fett sind, die mit einer sehr starken Energiezufuhr einhergehen und mit einer sehr hohen glykämischen Last. Glykämische Last bezeichnet das Maß, in dem der Blutzucker erhöht ist durch die Nahrungszufuhr. Lebensmittel mit einer sehr hohen glykämischen Last führen eben zu sehr stark und langfristig länger anhaltenden Blutzuckerspiegeln. Und das begünstigt den Aufbau von Körperfett und damit auch den Aufbau von viszeralem Fett. Aber was jetzt genau darüber entscheidet, ob wir eher Unterhautfett oder eher viszerales Fett aufbauen, das weiß man gar nicht so genau. Also das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch auch. Manche Menschen neigen stärker dazu, Bauchfettdepots anzulegen als andere. Andere neigen eher so zu Unterhautfettdepots. Man weiß, dass männliche Geschlechtshormone eher so eine viszerale Fetteinlagerung fördern. Deswegen sieht man ja diesen Apfeltyp eben sehr oft auch bei korpulenten Männern. Frauen neigen eher so zum Anlegen von Unterhautfettdepots. Bei Frauen kommt es oft erst nach der Menopause zu einer verstärkten Einlagerung von Bauchfett. Also offensichtlich spielen da Geschlechtshormone eine Rolle. Dann gibt es auch genetische Faktoren. Also zum einen so ein Krankheitsbild namens Lipodystrophie. Das besteht darin, dass der Aufbau von Unterhautfettdepots gestört ist und dass unnormal viel Bauchfett, viszerales Fett, eingelagert wird. Und dieses Krankheitsbild geht einher mit besonders schwerem Diabetes und vorzeitiger Alterung. Also da spielen genetische Faktoren eine Rolle. Und dann spielt auch das Darmmikrobiom eine Rolle. Inwiefern hat der Darm einen Einfluss? Ja, die Darmflora, also die Mikroben, die in unserem Darm leben, Bakterien unter anderem, die spielen eine große Rolle. Das weiß man inzwischen recht gut, unter anderem aus Tierversuchen an Mäusen. Also man weiß, wenn man die Darmflora von stark übergewichtigen Tieren auf normalgewichtige Tiere überträgt, dann werden die vorher normalgewichtigen Tiere ebenfalls stark übergewichtig. Also spielt die Darmflora da anscheinend eine große Rolle. Und man weiß, dass ähnliche Mechanismen auch beim Menschen wirken. Man weiß, dass bei stark übergewichtigen Personen so ein Ungleichgewicht besteht zwischen verschiedenen Bakteriengruppen der Darmflora. Also eine Rolle spielen da zum Beispiel die sogenannten Bacteroidota. Das ist so eine Bakteriengruppe, die unterrepräsentiert ist bei stark übergewichtigen Personen, während die Bacillota, das ist eine andere Bakteriengruppe, eher überrepräsentiert sind. Und diese verschiedenen Bakteriengruppen, die haben unterschiedliche Eigenschaften. Die unterscheiden sich darin, wie gut sie den Nahrungsbrei verwerten, der durch den Darm sich bewegt. Die unterscheiden sich darin, wie schnell sie die Nahrungsstoffe aus diesem Nahrungsbrei weitergeben an den Wirt, also an uns jetzt in dem Fall. Und deshalb unterscheiden sie sich eben darin, wie stark jetzt beispielsweise unser Blutzuckerspiegel ansteigt, nachdem wir irgendwas gegessen haben. Das hängt eben stark davon ab, welche Bakterien wir im Darm haben, weil die Bakterien eben einen Großteil der Verdauungsarbeit für uns erledigen. Man weiß, dass die Darmflora von stark übergewichtigen Personen weniger divers ist als die von normalgewichtigen. Also die ist artenärmer, was die Bakterien betrifft. Und vor allem infolge des westlichen Ernährungsstils büßt unser Mikrobiom, unsere Darmflora, an Vielfalt ein. Also sehr energiereiche und sehr hochverarbeitete Lebensmittel wie Fast Food und Snacks sind eher ungünstig, weil die werden überwiegend im oberen Teil des Darms verdaut. Deswegen kommt im unteren Teil des Darms nicht mehr so viel an von denen, aber dort haben wir die meisten Darmbakterien. Und wenn wir eben sehr hochverarbeitete Lebensmittel sehr intensiv konsumieren, dann laufen wir Gefahr, sozusagen die Darmbakterien im unteren Teil des Darms schlecht zu versorgen mit Nährstoffen. Die hungern dann und gehen zum Teil zugrunde, und dann verarmt die Darmflora. Das weiß man eben mittlerweile aus Untersuchungen. Ja, manche Mikroben wie die Bacillota, die wirken sich negativ auf den Stoffwechsel aus und gewinnen halt an Einfluss bei stark verarmter Darmflora. Okay, Frank, jetzt haben wir viel darüber gehört, wie es entsteht. Wie kriege ich es denn wieder weg, das viszerale Fett? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, und das ist auch gar nicht so leicht. Aber auf jeden Fall ist es schon mal wichtig, auf jeden Fall weniger Kalorien aufzunehmen und körperlich aktiver zu sein, um eben den Energiehaushalt wieder besser ins Gleichgewicht zu bringen. Viszeralfett baut sich im Körper schnell auf, aber auch schneller wieder ab als beispielsweise Unterhautfett. Und man weiß, dass schon wenige Kilo weniger reichen, um die negativen Folgen viszeraler Fettdepots einzudämmen, also in vielen Fällen zumindest. Da gibt es verschiedene Studien, die darauf hingedeutet haben. Eine davon ist die sogenannte Prediabetes Lifestyle Study des Deutschen Zentrums für Ernährungsforschung. Da hat man Untersuchungen gemacht an tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Diese Studie hat gezeigt, dass schon 5 % Gewichtsverlust zur Normalisierung der Blutzuckerwerte in fast jedem zweiten Fall geführt haben. Dass das dazu geführt hat, dass das viszerale Fett sich abgebaut hat und dass auch der Bauchumfang zurückgegangen ist und das Diabetesrisiko gesunken ist. Eine andere Studie ist die NutriAct Ernährungsstudie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung. Die hat gezeigt, dass die Umstellung auf ungesättigte Fettsäuren dazu führt, dass das viszerale Fett, das Bauchfett, sich abgebaut hat, dass die Cholesterinwerte zurückgegangen sind und dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Komplikationen auch gesunken ist. Dann gibt es noch die DirectPlus-Studie. In Israel läuft die an einem Kernforschungszentrum an übergewichtigen Personen. Die hat gezeigt, dass eine forcierte mediterrane Kost, die komplett ohne rotes Fleisch ausgekommen ist und besonders reich war an sekundären Pflanzenstoffen namens Polyphenole, die kommt zum Beispiel in Walnüssen. Wenn man das kombiniert hat mit moderatem Sport dreimal die Woche, dann hat das dazu geführt, dass anderthalb Jahre später das viszerale Fett um 14 Prozent zurückgegangen war. Also deutlich stärker zurückgegangen war als bei einer normalen Mittelmeerdiät oder bei klassischen Abnehmprogrammen. Das zeigt, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Polyphenole offensichtlich der Einlagerung vom Bauchfett entgegenwirken, weil sie eben antioxidativ und entzündungshemmend wirken und weil sie eben auch die eher günstigen Darmflora Arten fördern. Alles klar. Also das viszerale Fett entsteht eigentlich wie quasi anderes Fett, kann aber deutlich gefährlicher sein. Du hast ja auch gerade geschildert, wie man es dann auch wieder loswird. Es geht um das alte Thema Ernährung und Bewegung, natürlich. Und Frank, ich würde ganz zum Abschluss noch mal wissen: Also viele Menschen, die abnehmen oder abnehmen wollen, beklagen ja, dass sie dann auch schnell wieder zunehmen. Stichwort, ich glaube, Jojo Effekt wird das immer genannt. Was weiß man denn inzwischen darüber? Ja, das stimmt. Der Körper ist anscheinend sehr gut darin, sich an den Zustand des Übergewichts zu erinnern und den auch wieder herbeizuführen, wenn man abgenommen hat und die kalorienreduzierte Diät wieder abgesetzt hat. Das spielt auch bei den relativ neuen Abnehmspritzen eine Rolle, wie Osempic. Also man weiß, wenn die abgesetzt werden, dann kommt das auch eben wieder zu einer Wiederzunahme des Gewichts. Das ist das sogenannte Adipositas-Gedächtnis des Körpers, dass der Organismus eben diesen früheren Zustand des Übergewichts häufig wieder herbeiführt, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und man weiß inzwischen, dass das was zu tun hat mit Epigenetik. Also offensichtlich sind die Fettzellen, unter anderem des viszeralen Fetts, die sogenannten Adipozyten, epigenetisch verändert, wenn man stark übergewichtig ist. Die Verpackungsdichte der DNA ist verändert in diesen Zellen, und das führt unter anderem dazu, dass eben vor allem Gene aktiv sind, die an entzündlichen Prozessen mitwirken, die an Stressreaktionen mitwirken, die an Gewebevermehrung mitwirken. Und diese epigenetische Veränderung, die bleibt anscheinend länger erhalten, was eben dazu führt, dass Fettzellen, also Adipozyten im Bauchbereich, quasi vorbereitet bleiben für die Situation, wenn irgendwann mal wieder fettreiche Kost verfügbar ist und dass die dann in dem Fall auch sehr schnell Fettdepots wieder aufbauen. Das ist eben offensichtlich relativ hartnäckig, dieser Effekt. Man weiß aber, dass epigenetische Modifikationen durch Umwelteinflüsse und Lebensstil beeinflussbar sind. Und deshalb hat man die Hoffnung, dass durch Umstellung des Lebensstils, wenn der eben längerfristig ist, wenn man sich langfristig gesünder ernährt, langfristig körperlich aktiver ist, dann verbindet sich damit die Hoffnung, dass man damit auch irgendwann diese epigenetische Umprogrammierung der Fettzellen auch vielleicht wieder rückgängig machen kann und damit auch quasi das Adipositasgedächtnis hoffentlich irgendwann wieder löschen kann. Ganz spannendes Thema, das uns natürlich auch alle irgendwo betrifft, den einen mehr, die andere weniger. Mehr dazu erfahrt ihr auf spektrum.de, gerade zu diesem viszeralen Fett. Da findet ihr einen entsprechenden Artikel nochmal zum Nachlesen. Sehr, sehr spannend, auch wie sich das Ganze aufbaut und wie das dann aussieht. Und ja, Frank, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ja, danke von mir. Und von uns war es das für diese Woche vom Spektrum-Podcast. Euch wie immer vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Seid gern auch nächste Woche wieder dabei. Freitags gibt es eine neue Folge von uns. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast kommentiert, bewertet, wenn ihr den teilt und natürlich auch abonniert. Das hilft uns sehr. Dafür vielen, vielen Dank. Mein Name ist Max Zimmer und ich sage Tschüss und macht’s gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm.
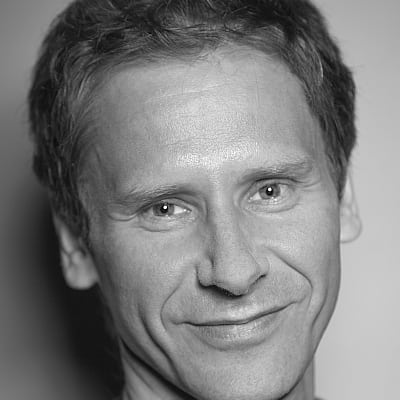 Foto: Spektrum der Wissenschaft
Foto: Spektrum der Wissenschaft
