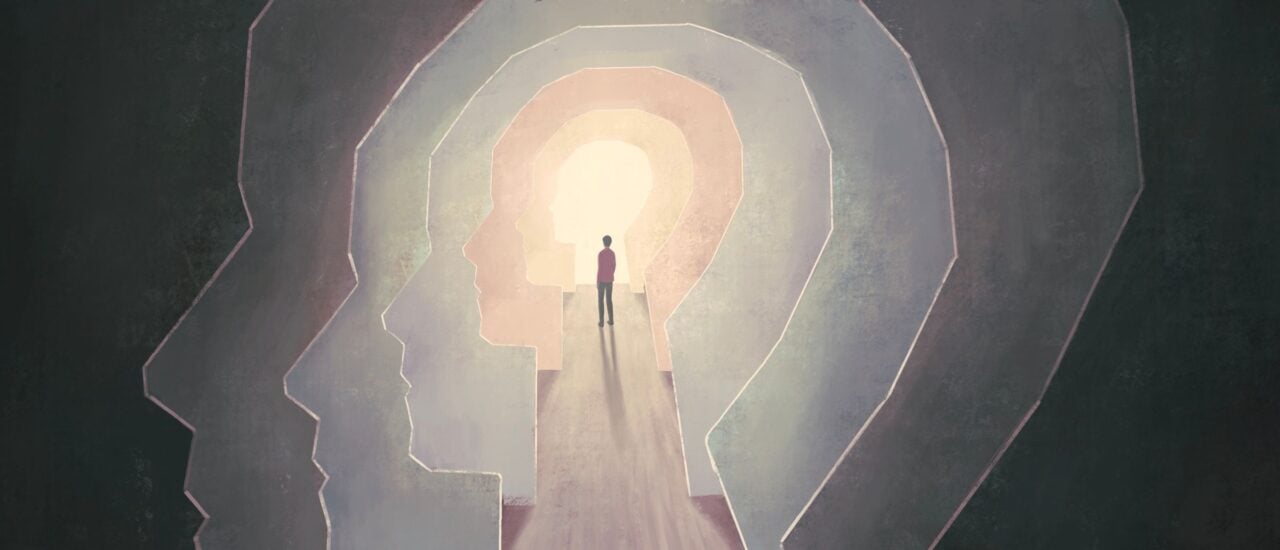Hey, schön, dass ihr diesen Podcast angeklickt habt. Das war sicher eure freie Entscheidung. Oder? Genauso wie ihr sicherlich ganz frei entschieden habt, auf welcher Plattform ihr diesen Podcast hören wollt. Und ich bin mir auch sicher, ihr habt euch selbst bestimmt ein Gerät gekauft, auf dem ihr diesen Podcast jetzt abspielt. Und dass ihr jetzt eure Ohren spitzt, das habt ihr doch selbst entschieden, oder? Worauf ich gerade hinaus will, ist eine der ältesten philosophischen Fragen überhaupt: Haben wir wirklich einen freien Willen, oder sind wir eigentlich vor allem Marionetten unserer Neuronen? Genau damit beschäftigen wir uns hier heute. Mein Name ist Jessi Jus von detektor.fm. Zurück zum Thema: Hat der Mensch einen freien Willen, oder sind unsere Neuronen eigentlich nur ein Teil der Natur? Unsere Entscheidungen sind eigentlich von ganz vielen Faktoren abhängig, deren Einfluss wir selbst gar nicht merken. Werbung und Marketing zum Beispiel, soziale Normen, Gewohnheiten oder auch biologische Faktoren. Die Antwort auf diese Frage beeinflusst unser Selbstbild, unser Rechtssystem und unser Zusammenleben. Deswegen gehen gleich mehrere wissenschaftliche Disziplinen dieser ziemlich großen Frage nach. In der Neurophilosophie reichen sich Philosophie und Hirnforschung die Hand. Hier werden abstrakte Fragen der Philosophie mit sehr konkreten Befunden der Hirnforschung zusammengedacht. Michael Paun arbeitet seit mehr als 25 Jahren genau in diesem Bereich, dem Grenzgebiet von Hirnforschung und Philosophie. Er ist Professor für Philosophie an der Berliner Humboldt Universität und zu Gast in unserem neuen Podcast „Die großen Fragen der Wissenschaft“. Den beiden Hosts Katharina Menne und Carsten Könnecker erklärt er, warum ein Experiment des Neurophysiologen Benjamin Libet aus den 80er Jahren 20 Jahre später für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat. Ja, wir haben ja den Namen Benjamin Libet jetzt schon mal gehört, und über die Experimente von diesem US-amerikanischen Physiologen ist ja eine große Debatte entbrannt, so in Deutschland in den Nullerjahren. Können Sie uns vielleicht noch einmal sagen, Herr Paun, worin diese Experimente eigentlich bestanden und warum sie dann mit etwas Zeitverzögerung zu dieser breiten Debatte, die sogar von Feuilletons geführt worden sind, ja, also wie das überhaupt sich so zugetragen hat? Ja, also die Zeitverzögerung war relativ groß. Das waren 20 oder noch mehr als 20 Jahre. Ja, das war so. Also Libet hatte in den relativ frühen 80er Jahren ein Experiment gemacht, mit dem er eigentlich zeigen wollte, dass es so etwas wie Freiheit gibt. Und das setzte seiner Meinung nach voraus, dass eine bewusste Entscheidung bestimmten Prozessen im Gehirn vorausgehen und diesen Prozessen im Gehirn sollte dann die Handlung folgen. Die Handlung, die er sich dazu ausgedacht hatte, war eine einfache Fingerbewegung. Und der Prozess im Gehirn, das war Mitte der 60er Jahre festgestellt worden, dass willentlich in Handlung ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial vorausgeht. Bereitschaftspotenzial ist eine Aktivität in den prämotorischen Arealen, die nach den Experimenten, die damals gemacht worden waren von Kornhuber und Deeke, eine Sekunde 500 Millisekunden vor einer Handlung entstehen. Und Libet hatte erwartet, dass seine Libet hat also sowohl den Zeitpunkt des Willensaktes, wenn also eine Person sich entschlossen hatte, eine Handlung zu vollziehen, wie auch den Zeitpunkt des Auftretens des Bereitschaftspotenzials gemessen. Und er hatte erwartet, dass der Willensakt oder sich das Bereitschaftspotenzial und damit die Steuerung oder Initierung der Handlung durch das Gehirn erst einsetzt, nachdem die Person sich entschieden hatte, die Handlung zu vollziehen. Und in dem Experiment kam aber heraus, dass das Gehirn zuerst reagiert und dann erst die willentliche Entscheidung kam. Also, es gibt quasi drei Ereignisse, wenn ich das richtig verstehe. Das eine ist, es gibt den Moment, wo eine Person sagt: „Ja, ich möchte jetzt meinen Finger krümmen.“ Dann gibt es das eigentliche Finger krümmen, was auch ein Beobachter sehen würde, und dann gibt es das Bereitschaftspotenzial im Gehirn, was quasi dieser Fingerkrümmung vorausgeht. Und jetzt geht es um die Reihenfolge dieser drei Ereignisse. Genau. Und wie gesagt, Libet erwartete, was wir wahrscheinlich auch erwarten würden, dass die Hirnaktivität erst nach der Entscheidung kommt. Und das Experiment schien aber zu zeigen, dass erst die Hirnreaktion kommt, dann trifft die Person die Entscheidung und dann bewegt sie den Finger. Und das ist dann so interpretiert worden, und das hat dann eben auch für dieses Aufsehen gesorgt. Das, was wir als freie Entscheidung betrachten, intuitiv, wird in Wirklichkeit durch das Gehirn bestimmt. Also das heißt, die sogenannte freie Entscheidung ist im Grunde genommen noch so ein bisschen Schauspiel, das nebenbei veranstaltet wird. Aber die eigentliche Entscheidung ist längst unbewusst durchs Gehirn getroffen, wenn wir denken, wir können uns noch entscheiden. Und das war einer der Gründe, das ist dann noch auf eine etwas, wie soll man sagen, kunstvoll dramatisierte Art und Weise dargestellt worden. Also dass jetzt unser ganzes Menschenbild widerlegt wird, dass man im Grunde genommen die Verbrecher aus den Gefängnissen entlassen müsse und so weiter und so fort. Sodass das eben auch ein entsprechendes Aufsehen erregt hat. Und es gab, war eben auch eine Zeit, in der die Neurowissenschaft eben sehr stark im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stand. Herr Paun, jetzt haben wir dieses spannende Experiment aus den 80er Jahren gehört. Benjamin Libet hat offenbar einerseits etwas herausgefunden, was seinen eigenen Annahmen widerspricht, andererseits aber vielleicht auch unserer aller Annahmen. Jetzt wurde diese Debatte offenbar wieder aufgewärmt. Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu? Warum hat man in Deutschland in den 2000er Jahren plötzlich diese alten Experimente aus der Schublade geholt und da nochmal neu drüber gesprochen? Ich glaube, es gab eine ganze Reihe von Gründen. Also einer der Gründe war wohl, dass es ein verstärktes Interesse an Neurowissenschaften gab. Zweiter Punkt war wohl, dass dieses Experiment einfach noch unbekannt war. Und dann ist dieses Experiment ein bisschen auch so eingeführt worden. Das war eben auch eine etwas aufgeregte Debatte, als wäre damit endgültig bewiesen worden, dass es keine Freiheit gibt. Und dann eben also einige der Beteiligten hatten auch eine oder haben teilweise bis heute eine Gabe der Aufmerksamkeit zu erregen und bestimmte Dinge sehr, wie soll man sagen, deutlich darzustellen. Und das hat natürlich mit dazu beigetragen. Wenn dann gesagt wird, ja, also wir müssen möglicherweise Strafen durch Mitleid ersetzen, das hat natürlich dann erst mal relativ viel Aufsehen erregt. Und auch in der FAZ hat es da über ein ganzes Jahr lang eine große Debatte gegeben, genau zu dem Thema. Da kamen viele Dinge zusammen. Die Libet-Experimente, die ja auch methodisch kritisiert worden sind, die jetzt ja auch gar nicht mehr total jung waren, die wurden ja auch nochmal von John Dillon Haynes in den Nullerjahren, in den späten Nullerjahren, wiederholt. Also, was kam denn da nochmal dabei raus? Ja, es waren, ich würde sagen, zwei Experimente waren sehr wichtig. Das eine Experiment ist mit Brain Scanning gemacht worden. Da hat man, oder eines der Probleme der Libet-Experimente war, dass man fragen kann: Hat es da wirklich eine Entscheidung gegeben? Also, was die Versuchspersonen machen sollten, war, sie sollten eine einfache Fingerbewegung machen. Und das Einzige, was daran überhaupt frei war, war, sie konnten den Zeitpunkt bestimmen. Das mit dem Zeitpunkt war aber auch nicht so richtig frei, weil die mussten innerhalb einer Begrenzungszeit diese Bewegung, ich glaube, 40 Mal wiederholen. Und wenn sie 40 Mal eine Bewegung wiederholen müssen, das von vornherein wissen, ob sie dann bei jeder einzelnen Bewegung eine Entscheidung fällen, ist eine Frage. Und was John Haynes gemacht hat, ist, er hat also in einem der Experimente gesagt, sie sollten entweder addieren oder subtrahieren und hat dann geguckt, mit einer Methode, die aus der Verteilung von Hirnaktivität, also nicht einfach nur der Summe der Hirnaktivität, sondern der relativ feinkörnigen Verteilung in bestimmten Arealen des Gehirns zu bestimmen, ab welchem Punkt kann man voraussagen, was die Versuchsperson machen wird: addieren oder subtrahieren. Und da hat er gezeigt, das war an der Stelle noch nicht addieren oder subtrahieren, da sollten die Leute erst mal nur auf den Knopf drücken. Da konnte er zeigen, dass man acht Sekunden vorher voraussagen kann, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, ob die auf den Knopf drücken würden oder nicht. Und dann hat er mit einem anderen Experiment noch gezeigt, dass man auch ein ganzes Stück vorher voraussagen kann, ob die Versuchspersonen addieren oder subtrahieren würden. Das war also mit einer etwas weiterentwickelten Methode. Und dann das dritte wichtige Experiment, da ging es um das Veto. Also Libet hatte schon zu zeigen versucht, also Libet wollte eigentlich zeigen, dass es Freiheit gibt, und mit dem Hauptteil des Experiments aus dem schien das nicht hervorzugehen. Dann hat er noch ein sogenanntes Veto-Experiment gemacht, wo die Versuchspersonen eine Bewegung brechen sollten. Und nach der Interpretation von Libet konnte er dann zeigen, dass noch nach dem Auftreten des Bereitschaftspotenzials die Bewegung abgebrochen werden konnte, was zu zeigen schien, jedenfalls nach Libets Interpretation, dass das Bereitschaftspotenzial die Handlung nicht determiniert, also keine Widerlegung von Willensfreiheit bringt. Also das Veto-Experiment war noch problematischer als das ursprüngliche Experiment. Ich meine, auch das Veto, das können wir heute vielleicht sagen, das Experiment war aber extrem wichtig damals und es war ein wichtiger methodischer Fortschritt. Also man muss immer gucken, wie war das aus der Sicht der damaligen Zeit und was können wir heute dazu sagen. Und diese beiden Perspektiven muss man, glaube ich, trennen. Und Haynes konnte jetzt voraussagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, was die Probanden dann tun würden. Also, ob sie ohne es vorher zu kommunizieren, ob sie addieren oder subtrahieren. Genau, ja. Das konnte also mit einer, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Zahlen waren, irgendwas um 60 oder 70 Prozent. Das ist natürlich aus methodischer Sicht wichtig und interessant. Und er konnte, ich glaube, sechs Sekunden oder acht Sekunden vorher voraussagen, auf welchen Knopf die drücken würden. Die Voraussage war da wesentlich einfacher. Aber das heißt nicht, dass unsere Entscheidung sechs oder acht Sekunden, bevor wir also unsere Handlung, sechs oder acht Sekunden, bevor wir uns entscheiden, schon feststeht. Ja, da würde man also zumindest in Berlin niemals lebend über eine Straße kommen. Ein Zusammenschnitt unseres Podcasts „Die großen Fragen der Wissenschaft“. Der Philosoph Michael Paun erklärt hier, warum die Libet-Experimente unseren freien Willen nicht widerlegen und wieso Philosophie und Hirnforschung oft zusammengehören. Wenn ihr den Podcast nochmal in voller Länge hören wollt, dann klickt einfach auf den dazugehörigen Link in den Shownotes. Das war nämlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Podcast. In jeder Folge widmen sich Katharina Menne und Carsten Könnecker von Spektrum der Wissenschaft ganz ausführlich einem der größten Rätsel der Wissenschaft. Und das kann dann schon mal anderthalb Stunden dauern. Jeden Monat kommt eine neue Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall, reinzuhören und den Podcast zu abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Das war’s von mir für heute. Diese Folge hat Tim Schmutzler produziert, und ich bin Jessi Jus. Ciao! Bis zum nächsten Mal.