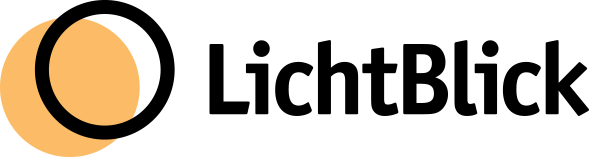Die 50 reichsten MilliardärInnen der Welt verursachen in 90 Minuten mehr Treibhausgase als ein Mensch im weltweiten Durchschnitt in seinem ganzen Leben. Und während die reichen Industrienationen im globalen Norden die Erderwärmung verursachen, sind es Menschen in ärmeren Ländern im globalen Süden, die unter den Folgen leiden, mit weniger Möglichkeiten, sich zu schützen. Die Klimakrise ist also von Ungerechtigkeit geprägt. Wie sorgen wir für mehr Klimagerechtigkeit? Ihr hört den Klimapodcast von detektor.fm, und ich bin eure Host Ina Lebedjev. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mission Energiewende. Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter, mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 % Ökostrom. Ende Juni hat mit Amazon-Gründer Jeff Bezos einer der reichsten Menschen der Welt geheiratet und damit für ordentlich Aufsehen gesorgt. Seine Hochzeit feierte er in Venedig, der europäischen Stadt, die mit am stärksten unter der Klimakrise und dem Massen-Tourismus leidet. Entsprechend lautstark war der Protest gegen die Feier. Auf einem Banner, das auf dem zentralen Markusplatz ausgerollt wurde, forderten Gruppen wie Greenpeace sinngemäß: Wer Venedig mieten kann, der kann auch angemessene Steuern zahlen. Damit machten die AktivistInnen darauf aufmerksam, dass Superreiche wie Jeff Bezos sich oft davor drücken, Abgaben an den Staat zu zahlen und stattdessen das Geld für ihren Luxus Lifestyle ausgeben, der wiederum Städte wie Venedig bedroht und die Klimakrise für alle anheizt. Zu Bezos‘ Hochzeit reisten die Gäste in mehr als 90 Privatjets an, was eine enorme Menge an Emissionen bedeutet hat. Im Internet gingen daraufhin die Diskussionen los. Viele Menschen haben sich gefragt, warum sie sich eigentlich anstrengen sollten, klimafreundlich zu leben, wenn Superreiche wie Bezos mit nur einer Feier mehr Emissionen ausstoßen als sie in ihrem ganzen Leben. Was muss also passieren, um diese Ungerechtigkeit auszugleichen, und was bringt die oft geforderte Vermögenssteuer fürs Klima? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Marisa Becker. Hallo Marisa. Hallo Ina. Ja, du hast ja jetzt eine ganze Zeit damit zugebracht, zu Klimaungerechtigkeit und sozialer Ungleichheit zu recherchieren. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, beide Themen zusammenzudenken? Du hast das Eingang schon ziemlich gut zusammengefasst. Das Kernproblem der Klimakrise ist, dass die reichen Länder und reichen Teile der Weltbevölkerung übermäßig viel zur Klimakrise beitragen, aber nicht oder deutlich weniger unter den Folgen der Krise leiden. Das tun vor allem Länder im globalen Süden, und die haben oft nicht die Mittel, sich und ihre Bevölkerung ausreichend zu schützen. Lass uns zum Beispiel mal auf Madagaskar schauen. Das ist ein Land, das heute schon ziemlich stark unter der Klimakrise leidet. Es ist sogar neben Indien und Bangladesch unter den Top 3 der betroffenen Länder, und das wird sich in Zukunft verstärken. Die Situation dort ist wirklich dramatisch. Die Mehrheit der Menschen lebt unterhalb der Armutsgrenze, hat also weniger als 2,15 Dollar pro Tag zum Leben zur Verfügung. Und wenn die Klimakrise dann dafür sorgt, dass Dürren, Überschwemmungen und andere Extremwetterereignisse häufiger vorkommen, dann bedroht das die Menschen dort wirklich existenziell. Es ist also kaum möglich, die Klimakrise und die Frage nach Klimagerechtigkeit getrennt von sozialer Ungleichheit zu betrachten. Denn sie sorgt dafür, dass diese Schere immer weiter aufgeht, weil sich die Armen eben nicht so gut schützen können und dadurch noch ärmer werden. Die Klimakrise verstärkt also die Ungleichheit, und gleichzeitig verstärkt die Ungleichheit auch die Klimakrise. Okay, und wie meinst du das genau? Es ist so, dass sehr reiche Menschen durch ihre Luxustransportmittel, aber auch durch ihre Investitionen in klimaschädliche Unternehmen extrem viel CO2 ausstoßen, was die Klimakrise einfach anheizt. In welcher Größenordnung wir uns da bewegen, das habe ich Manuel Schmidt gefragt. Er ist Referent für das Thema soziale Ungleichheit bei Oxfam. Die Organisation hat in den vergangenen Jahren mehrere Berichte rausgegeben, die sich mit der Rolle von Superreichen in der Klimakrise auseinandersetzen. Und dann sehen wir, dass alleine das weltweit reichste Prozent der Weltbevölkerung für genauso viele Emissionen verantwortlich ist wie die ärmeren zwei Drittel der Menschheit. Und wenn wir uns jetzt nochmal ganz gezielt die Emissionen der Reichsten der Reichen anschauen, also von Milliardärinnen, dann sehen wir, dass 50 der reichsten Milliardärinnen der Welt durch ihre Investitionen, Luxusjachten und Privatjets innerhalb von nur rund 90 Minuten mehr CO2 ausstoßen als ein Mensch im weltweiten Durchschnitt im gesamten Leben. Und die Gesamtemissionen nur dieser 50 Superreichen sind höher als die Emissionen der ärmsten zwei Prozent der Menschheit zusammen. Also auch anders ausgedrückt: 50 Menschen sind für mehr Emissionen verantwortlich als 155 Millionen Menschen zusammengenommen. Und diese Menge an Emissionen, die können sie eben nur produzieren, weil sie so unfassbar viel Geld haben. Und insofern verstärkt diese Ungleichheit eben auch die Klimakrise. Wer gilt denn laut der Studie von Oxfam als Superreich? Also man muss sagen, es gibt dazu keine einheitliche Definition, auf die man da zurückgreifen kann, weil auch diese ganzen Reichenlisten und Datenbanken da unterschiedliche Grenzen setzen. Manuel Schmidt hat mir aber gesagt, dass sie die Grenze so bei 100 Millionen Euro beziehungsweise Dollarvermögen setzen. Wie wird denn berechnet, wie viele Emissionen diese Superreichen verursachen? Oxfam hat sich für seine Berichte die Daten zu Investitionen und zu Luxustransportmitteln, also sowas wie Yachten und Privatjets, angesehen. Aber ich muss gleich vorweg sagen, es gibt Lücken in dieser Berechnung, weil natürlich nicht alles dokumentiert ist. Deswegen sind wissenschaftliche Studien, Forschung und auch wir angewiesen auf Datensammlungen von auch privaten Anbietern. Also zum Beispiel Vermögensdaten von Großbanken wie der schon genannten UBS oder auch Reichenmagazinen wie Forbes oder Bloomberg. Und zur Berechnung der Investitionsemissionen von Milliardären haben wir in diesem Fall die Bloomberg-Reichenliste herangezogen, weil sie nochmal detailliertere Informationen über den Besitz von Unternehmen und Konzernen bereitstellt als andere Reichenlisten. Und dann kann man halt die Emissionen der Unternehmen aufgrund der Geschäftsberichte ganz gut nachvollziehen und diese dann anteilig den Besitzerinnen, also den Superreichen, dann auch zuordnen. Und bei den Emissionen von Privatjets und Luxusjachten sind wir letztendlich vor allem öffentliche Quellen wie Medienberichte und Fotos genutzt und dann auch spezialisierte Internetseiten. Und über Trackingseiten, also sobald man halt die Transportmittel den Superreichen zuordnen konnte, auf Trackingseiten kann man dann die zurückgelegten Strecken ermitteln und dann auf dieser Grundlage halt dann auch die Emissionen berechnen. Das heißt aber auch, die ganzen Schätzungen, die Oxfam da rausgibt, die sind eher konservativ zu verstehen. Da drin sind zum Beispiel noch nicht die Emissionen durch Gebäude, Lebensmittel oder auch Autofahrten enthalten. Und auch ob wirklich alle Flüge, die die eben unternommen haben, von einem Privatjet erfasst werden konnten, ist einfach völlig unklar. Ich habe neulich mal eine Doku gesehen, darüber wie extrem sich der Tourismus von sehr reichen Menschen auf Mallorca auswirkt. Und da sind mir ein paar Punkte aufgefallen, dass es eben gefüllte Pools für ein, zwei Gäste gibt, während anderswo eben eine große Gästescharte den Pool benutzt. Oder der Aspekt, dass man Champagner, frische Austern oder andere Luxuslebensmittel einfliegen lässt. Wenn ich mir jetzt also vorstelle, dass die Emissionen der Superreichen ziemlich wahrscheinlich noch viel höher sind als die konservative Schätzung das vermuten lässt, dann ist es ja denkbar, dass das bei vielen Menschen auch ein Gefühl der Machtlosigkeit auslöst. Was bringt es denn, wenn ich mich im Alltag einschränke, darauf verzichte, meinen Kindern die Welt zu zeigen und sie selber zu entdecken und so weiter? Was bringt das? Hat das überhaupt einen Einfluss? Also mit Blick auf die globalen Emissionen muss man leider sagen: weniger. Denn die meisten Emissionen, die wir verursachen, sind eher infrastruktureller Natur. Das können wir also gar nicht so individuell steuern. Das heißt nicht, dass nicht jeder seinen Beitrag leisten soll und darf. Lass mich da mal ein Beispiel bringen. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Biokiste vom Landwirtschaftsbetrieb im Nachbardorf kaufe, dann unterstütze ich diesen Betrieb finanziell und trage dazu bei, dass dieses nachhaltige Unternehmen besteht. Und das ist natürlich gut. Aber wir haben eben, was die meisten Emissionen betrifft, selbst nur einen relativ kleinen Hebel. Da muss also systemisch etwas verändert werden. Und Manuel Schmidt von Oxfam hat mir noch einen weiteren Grund genannt, warum unsere individuellen Anstrengungen letztlich nicht reichen werden. Zweitens wird bei den jetzigen derzeitigen Raten alleine der übermäßige Konsum des weltweit reichsten Prozents bis zum Jahr 2070 unser gesamtes als Menschheit verbleibendes CO2-Budget aufbrauchen, um die 1,5 Grad-Grenze noch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einhalten zu können. Oder anders ausgedrückt: Selbst wenn die restlichen 99 Prozent der Menschheit heute aufhören würden, Emissionen zu verursachen, würde alleine das reichste Prozent unser gesamtes Budget bis 2070 verpulvert haben. Und das verdeutlicht nochmal, dass es dringend notwendig ist, die Emissionen von reichen und superreichen auch wirklich in den politischen Fokus zu rücken und so schnell wie möglich zu reduzieren. Insofern kann man glaube ich mitnehmen, dass wir, die wir in einer Demokratie leben, vor allem unsere politische Entscheidungsmacht nutzen müssen, um die Emissionen im System einfach wirklich runterzukriegen. Verkehr, Energie, Gebäudesektor – hier müssen wir die Weichen stellen, und dafür bedarf es einfach politischer Entscheidungen. Und natürlich ist das auch der Weg, wie man diese Verteilungsfrage angehen kann. Hast du da schon was Konkretes im Sinn? Ja, die Vermögensteuer ist zum Beispiel ein Weg, wie man die finanziellen Ressourcen in Deutschland gerechter verteilen könnte, und die ist auch eine der Kernforderungen von Oxfam, die sich ja wirklich sehr tiefgehend mit dem Thema soziale Ungleichheit auseinandergesetzt haben. Sie schlagen vor, die international diskutierte Mindeststeuer von zwei Prozent auf Vermögen einzuführen. Das könnte Deutschland je nach Ausgestaltung natürlich bis zu 28 Milliarden Euro einbringen und würde nur etwa 250 bis 500 Haushalte betreffen. Aber nicht nur Oxfam fordert das, sondern zum Beispiel auch die Initiative Tax Me Now. Das ist eine Bewegung von selbst sehr vermögenden Menschen aus dem DACH-Raum, also Österreich, Schweiz und Deutschland, die eben sagen: Wir werden nicht angemessen besteuert. Ihre These ist, dass Steuergerechtigkeit ein Fundament für unser menschliches Zusammenleben ist und auch sehr wichtig für unseren Planeten und für die Demokratie. Peter Rehse ist Teil von Tax Me Now, und ich habe ihn im Rahmen meiner Recherche zum Interview getroffen. Er ist selbst durch den Verkauf eines Unternehmens vermögend geworden, und er sagt eben: Wir haben echt viele Ungerechtigkeiten in unserem Steuersystem. Das fängt bei in Anführungszeichen kleinen Millionenvermögen schon an, dass wir sehr viele Ausnahmen haben, die den normalen Menschen in Anführungszeichen normal überhaupt nicht klar sind, weil dieser Gestaltungsspielraum nur für Vermögen in der Regel greift. Da haben wir in Einzelnen sehr viele Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer. Vermögensteuer ist ausgesetzt. Die Besteuerung von Unternehmensgewinnen wird jetzt wieder weiter reduziert. Die einzige Steuer, die Milliardäre überhaupt noch bezahlen, Immobilien sind nach einer Haltefrist von zehn Jahren steuerfrei. Da werden große Gewinne mitgemacht, und so addieren sich die vielen kleinen Maßnahmen auf wie eine Perle auf einer Perlenkette, die den letzten 40 Jahren also Löcher in unser Steuerrecht geschossen wurden, die eigentlich immer nur Hochvermögen zugutekommen. Und diese Ausnahmen sorgen dafür, dass MilliardärInnen effektiv nur 26 Prozent Steuerlast tragen, obwohl sie natürlich viel mehr tragen könnten. Gleichzeitig wird aber im Einkommen von knapp 70.000 Euro der Spitzensteuersatz von 42 Prozent erhoben. Okay, superreiche zahlen also prozentual gesehen teilweise weniger Steuern als Menschen mit normalem Einkommen. Dass da eine Ungerechtigkeit vorliegt, leuchtet ein. Aber inwiefern soll eine gerechte Besteuerung dazu beitragen, die Klimakrise zu bremsen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, die wirklich großen Moves, also diese großen strukturellen Veränderungen, die muss einfach der Staat vornehmen, und dafür braucht er natürlich Geld. Und dieses Geld ist auch vorhanden, wird nur eben nicht vom Staat, ich sag mal, abgerufen in Form einer gerechten Besteuerung für Vermögende. Das sagt zumindest Peter Rehse. Auf das Bruttosozialprodukt des Planeten hochgerechnet ist die Aufgabe, die vor uns liegt, lösbar. Aber diese Vermögen werden eben überhaupt nicht herangezogen. Und das ist sozusagen ein Versäumnis, das sich sozusagen uns der Klasse der Vermögenden wirklich vorwerfen muss, dass wir, wenn schon der Staat das nicht besteuert, weil unsere Lobbyisten das Steuerrecht sturmreif geschossen haben, wir auch diese Ressourcen nicht einsetzen, um die Klimakrise zu bewältigen, sondern im Gegenteil unsere Lobbyisten losschicken, um Öl und Gas und sogar eine Kohleindustrie weiter zu schützen. Für ihn ist die gerechte Besteuerung also einer der wichtigsten Hebel. Gleichzeitig müssen Vermögende aber auch Verantwortung übernehmen und dürfen eben nicht weiter in klimaschädliche Industrien investieren. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Ihr wollt 100 Prozent Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E- Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Aber es gibt doch auch einige Prominente. Ich denke da zum Beispiel an Leonardo DiCaprio, die sich ja durchaus für das Klima einsetzen und zwar auch sehr öffentlichkeitswirksam. Muss man da vielleicht an einigen Stellen einen Unterschied machen zwischen den Superreichen, über die man spricht? Leonardo DiCaprio ist wirklich ein gutes Beispiel, weil er ja wirklich sehr für sein Engagement gesehen und auch gefeiert wird. Aber zum Beispiel auch zur Hochzeit von Jeff Bezos in Venedig gereist ist und dafür auch stark kritisiert wurde, weil das ja erstmal, ich würde sagen, stark im Gegensatz zu seinem „Ich rette den Planeten“-Image steht. Und genau dieser Gegensatz sorgt auch insgesamt dafür, dass DiCaprio eher kein gutes Öko-Vorbild ist. Das sagt zumindest Dr. Björn Wendt, der an der Universität Münster arbeitet und unter anderem zu Vorbildern in der Klimabewegung forscht. Erstens können diese Prominenten oder Reichen die Rolle von klimatischen Vorbildern nur sehr begrenzt mit Blick auf ihre eigene konkrete Lebensführung erfüllen. Man denke etwa an die viel klimaschädlichen Reisen mit Privatjets und Luxusjachten sowie den hohen Ressourcenverbrauch, der dieser Art von Leben eingeschrieben ist. Und dieser Widerspruch zwischen ökologischer Rhetorik und nicht nachhaltiger sozialer Praxis begrenzt die Vorbildfunktion erheblich, würde ich sagen, und kann vor allem auch von antiökologischen Bewegungen als Öko-Bigotterie politisiert werden. Das heißt jetzt nicht, dass Veganismus oder andere Praktiken von der Gefolgschaft der jeweiligen Prominenten zum Beispiel nicht durchaus als Vorbild bei den Fans der jeweiligen Künstlerinnen fungieren könnten. Aber diese Strahlkraft ist gesamtgesellschaftlich doch sehr begrenzt. Gleichzeitig sagt Dr. Böhm Wendt, ist es übrigens so, dass dieses Luxusleben auf uns eine enorme Anziehungskraft hat, weil wir in unserer kapitalistisch geprägten Gesellschaft unsere Identität zu großen Teilen auch über unseren Konsum ausdrücken. Und Konsum ist deshalb eben immer noch sehr positiv konnotiert. In diesem Setting alle ökologischen und sozialen Zusammenhänge zu hinterfragen, das würde uns vor unlösbare Fragen stellen. Und auch deshalb ist die Vorbildfunktion von sehr vermögenden Menschen einfach sehr begrenzt. Aber Promis wie Leonardo DiCaprio spenden ja auch relativ große Summen. Zuletzt hat er zum Beispiel eine Million Dollar für die Waldbrandhilfe in L.A. gespendet, habe ich gelesen. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos hat in den vergangenen Jahren 10 Milliarden Dollar für den Klimaschutz gespendet. Da fließt also durchaus Geld von den Vermögenden in den Klimaschutz. Muss die Umverteilung also zwangsläufig über den Staat laufen? Das habe ich auch Peter Rehse von Tax Me Now gefragt, und er sagt ziemlich klar: Ja, nicht ausschließlich. Es darf und soll natürlich auch andere Wege wie zum Beispiel eben Philanthropie also Spenden geben. Aber er findet es eben ungerecht, dass wir besonders die starken Schultern im Moment nicht heranziehen, um öffentliche Aufgaben zu finanzieren. Also Philanthropie ist ja nett, aber sie löst unser strukturelles Problem nicht. Vermögende spenden auch nur einen verschwindend geringen Anteil ihres verfügbaren Vermögens oder Einkommens. Umso ärmer Menschen sind, umso höher spenden sie den Anteil ihres Budgets. Das ist erstaunlich. Und bei Milliardären nehmen sich diese Spenden, mit denen sie sich gerne öffentlich schmücken, im Promillebereich ihrer Möglichkeiten aus. Also das ist eher ein Feigenblatt und eine Nebelkerze in der Diskussion. Was wir brauchen, ist das Heranziehen verfügbarer Ressourcen, um die Probleme zu lösen. Ich muss da noch mal kurz einhaken, weil ich das ausgesprochen interessant fand. Es gibt ja so Berechnungen zur Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sanchez. Etwa 46 Millionen Euro soll das Fest in Venedig gekostet haben. Das sind geschätzt 0,01 Prozent seines Vermögens. Und da gab es Satiriker, JournalistInnen, ich habe keine Ahnung, wer im Internet damit zuerst um die Ecke gekommen ist. Die haben dann mal ausgerechnet, was das für einen Durchschnittsbürger bedeuten würde. Also wenn man das ins Verhältnis setzt, und die Zahlen liegen irgendwo zwischen 18 und 23 Euro, die sozusagen ein Normalbürger für ein Hochzeitsfest ausgegeben hätte. Ja, da kann man sich vorstellen, wie groß dieses Hochzeitsfest ungefähr ausgefallen wäre. Also da sieht man, eben diese 10 Milliarden von Bezos, die er für den Kampf gegen die Klimakrise gespendet hat. Die mögen zwar erstmal viel klingen, aber wenn man das dann auf sein Vermögen von geschätzt 240 Milliarden runterrechnet, dann sind das eben gerade mal 4 Prozent. Und dieser Mensch ist immer noch absurd vermögend. Und nochmal zurück zum Kern: Mit einer Vermögenssteuer hat der Staat einfach die Möglichkeit, ganz andere Summen abzurufen. Und zwar von jeder vermögenden Person und nicht nur von denen, die das freiwillig wollen. Mit einer Vermögenssteuer könnte der Staat also zuverlässig größere Summen an Geld einsammeln. Wenn der Staat auf dem Geld sitzen bleibt, dann bringt das aber niemandem was. Was muss der Staat also mit dem Geld machen, damit es wirklich gegen die Klimakrise wirkt? Also erstmal muss man ja sehen, dass das Geld, was den Superreichen so genommen wird, in Anführungszeichen, Geld ist, das sie eben nicht mehr für Luxustransport oder eben klimaschädliche Investitionen ausgeben können. Und das ist erstmal gut fürs Klima. Aber natürlich muss der Staat damit arbeiten, damit es eben wirklich etwas gegen die Klimakrise tun kann. Und Oxfam schlägt zum Beispiel vor, dass dieses Geld am besten in den globalen Süden fließen sollte. Also es braucht unserer Ansicht nach insbesondere jetzt für die Länder des globalen Südens deutlich mehr finanzielle Unterstützung, damit sie einerseits ihre Emissionen auch reduzieren können und gleichzeitig halt ihre Bevölkerung auch besser vor Schäden schützen können. Auf der letzten Weltklimakonferenz wurde beispielsweise das Ziel beschlossen, die Unterstützung einkommensschwacher Länder auf jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar anzuheben. Noch steht heute immer unklar, woher genau das Geld kommen soll. Aber sicher ist auf jeden Fall, die Unterstützung durch reiche Industrieländer wird weiter wachsen müssen. Und unserer Ansicht nach sollten sich die Länder das Geld von denjenigen holen, die davon im Überfluss haben. Und das sind nun mal die Reichen und Superreichen dieser Welt. Es ist aber fraglich, ob das ausreicht oder ob man nicht ab einem gewissen Punkt sagen müsste: So etwas wie Privatjets, das verbieten wir einfach. Oxfam ist auf jeden Fall der Meinung, dass wir über die Vermögensteuer hinausgehen müssen, wenn wir der Klimakrise wirklich etwas entgegensetzen wollen und so etwas wie Privatjets und Yachten viel stärker regulieren bis verbieten müssen. Okay, das heißt, was wäre der Masterplan, um Klimaungerechtigkeit abzuschaffen oder die Welt zumindest ein bisschen klimagerechter zu machen? Aus Sicht von Oxfam braucht es erstens die Vermögensteuer, damit Superreiche sich einfach stärker an der Abfederung der Klimaschäden im globalen Süden beteiligen. Das sorgt eben dann insofern für mehr Klimagerechtigkeit, als dass diejenigen, die die Schäden maßgeblich verursacht haben, auch für sie aufkommen müssen. Und dann müssen wir eben sagen: So etwas wie Privatjets und Superjachten, das verbieten wir eventuell, weil es eben enorm viele Emissionen verursacht. Und mal so als kleiner Reminder: Allein die Yachten des Milliardärs Klaus Michael Kühne verursachten laut Oxfam binnen eines Jahres Emissionen von knapp 9800 Tonnen an CO2-Äquivalenten. Mal so als Vergleich, um das ein bisschen einzuordnen: Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck eines Deutschen liegt bei irgendwas zwischen 7 und 8 Tonnen pro Jahr. Das sind also echt richtig, richtig hohe Emissionen, über die wir da sprechen. Und drittens fordert Oxfam eine konsequente Abkehr von allen fossilen Energiequellen. Und das muss wirklich strukturell auf Ebene der Staaten passieren. Und ist es absehbar, dass so etwas mit der aktuellen Regierung bei uns kommt? Eher nicht. Also aktuell sieht es nicht so aus, als würde das kommen. Das Thema Vermögensteuer wurde ja im Wahlkampf relativ hitzig diskutiert, wobei die Union da schon die ganze Zeit die Position eingenommen hat, dass sie eben keine Vermögensteuer einführen wollen, um eben Menschen, die wie sie sagen, hart gearbeitet haben, nicht zu bestrafen. Die SPD hingegen wollte die stärksten Schultern in der Gesellschaft mehr in die Verantwortung ziehen. Jetzt haben die eine Regierung gebildet, und in den Koalitionsverhandlungen scheint sich da die Union durchgesetzt zu haben. Denn von der Vermögensteuer steht im Koalitionsvertrag nichts drin. Meine Kollegin Marisa Becker hat zur Rolle von Superreichen in der Klimakrise recherchiert. Liebe Marisa, vielen Dank für diese Recherchen und für deinen Einblick, den du uns gegeben hast. Danke dir! Gerne! Das war der Klima-Podcast von detektor.fm für heute. Wenn ihr über die nächsten Folgen rund um den Klimaschutz informiert bleiben wollt, dann folgt doch dem Podcast in der Podcast-App eurer Wahl und empfiehlt uns gerne weiter. Die Audioproduktion für diese Folge hatte Benjamin Serdani. Und die Redaktion lag bei mir. Ich bin Ina Lebedjev und sage ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht’s gut! Tschüss! Mission Energiewende. Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter, mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 % Ökostrom.
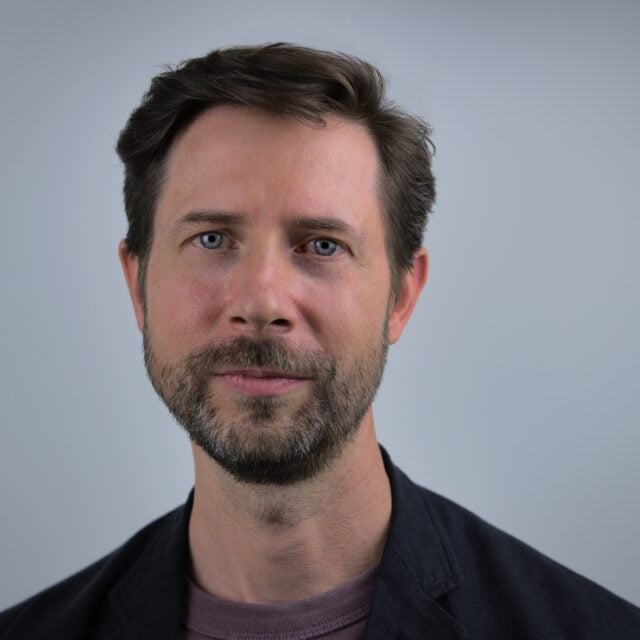 Foto: Yannik Yesilgöz/Oxfam
Foto: Yannik Yesilgöz/Oxfam