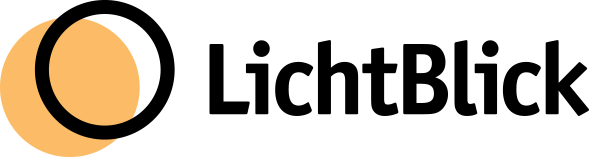Illegal, grob fahrlässig, vorsätzlich und zum Schaden unseres Planeten. So handeln Menschen, die sogenannte Umweltverbrechen begehen. Beispiele sind etwa der Abgas-Skandal von VW, die Rodung des Amazonas-Regenwaldes, das Deepwater-Horizon-Unglück und die Ölpest im Golf von Mexiko, die daraus folgte. Aber was treibt die TäterInnen eigentlich an? Ist es einfach nur Gier? Und was können wir tun, um dem etwas entgegenzusetzen? Darum geht es heute. Ihr hört den Klima Podcast von detektor.fm. Ich bin Ina Lebedjev. Hi! Mission Energiewende – Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 Prozent Ökostrom. Wusstet ihr, dass es einige konkrete psychologische Faktoren gibt, die Umweltkriminelle antreiben? Eine, die sich damit auskennt, ist Julia Shaw. 1987 in Köln geboren und in Kanada aufgewachsen. Sie ist Bestseller-Autorin, internationale Referentin und forscht als promovierte Rechtspsychologin am University College in London. In den vergangenen Jahren hat sie sich in ihren Büchern mit falschen Erinnerungen und der Psychologie unserer Abgründe auseinandergesetzt. In ihrem neuen Buch „Green Crime“ geht Julia Shaw der Frage nach, warum Menschen Umweltverbrechen begehen. Sie hat sich dafür sechs der größten Umweltverbrechen der vergangenen Jahrzehnte vorgenommen und jeweils Fallprofile erstellt, um herauszufinden, was die TäterInnen antreibt und auch, wie man solche Verbrechen verhindern kann. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei uns im Studio über ihre Erkenntnisse sprechen können. Erstmal ganz herzlich willkommen bei detektor.fm und natürlich hier im Klimapodcast. Schön, dass du da bist. Hi! Ich habe jetzt schon ein paar Mal von sogenannten Umweltverbrechen gesprochen. Erstmal würde mich interessieren: Gibt es einen Unterschied zu anderen, zu normalen Gewaltverbrechen, den du als Kriminalpsychologin herausstellen würdest? Ja, definitiv. Das hat mich auch selbst überrascht, muss ich sagen. Ich dachte, man kann einfach so reingreifen in die Kiste der Kriminalpsychologie und einfach dieselben Instrumente rausholen. Und dann kann man einfach Umweltverbrechen erklären. Und das ist nicht der Fall, weil das sind vor allem organisierte Verbrecher. Also was wichtig ist, ist zu verstehen, dass es im Gegensatz zum Gewaltverbrechen selten ein spontaner Moment ist. Vor allem diese großen Straftaten, von denen ich in dem Buch schreibe, das sind halt der VW-Dieselskandal, das sind Wilderer Banden in Südafrika und in China. Das sind Piraten, eigentlich, oder Menschen, die illegalen Fischfang begehen. Also das sind große Verbrechen, wo auch mehrere Menschen beteiligt sind. Und das wird halt sehr geplant. Und das ist nicht so bei Gewaltverbrechen meistens. Und dementsprechend muss man sich dann eher die Psychologie von organisierten Verbrechern angucken. Also in dem Sinne ja, das ähnelt sich, aber nicht unbedingt das. Also zum Beispiel die Idee, dass es vielleicht alles Psychopathen sind, das macht keinen Sinn. Okay, du hast für das Buch, du hast es gerade schon angesprochen, ganz verschiedene Umweltverbrechen angeschaut, unter anderem eben den Dieselskandal von VW. Du forschst ja auch zu Erinnerungen. Wie sollten wir uns denn an dieses Umweltverbrechen erinnern? Oder wie tun wir es tatsächlich? Das finde ich ganz interessant. An dem VW-Skandal ist, dass die meisten Menschen sich entweder, glaube ich, nicht so richtig… Ich glaube, viele haben es nicht so richtig verstanden, auch zu der Zeit. Und das ist ja zum Teil Absicht gewesen. Also ich schreibe ja auch darüber, dass VW und mehrere Angehörige von VW haben halt immer wieder gelogen. Es waren zehn Jahre, dass sie Dirty Diesels, die sie Clean Diesels genannt haben, in Amerika produziert haben und verkauft haben weltweit. Und diese Dieselautos, also wer sich nicht daran erinnern kann, kurzer Recap: Diese Dieselautos haben halt Stickoxide ausgestoßen, die 40 Mal höher waren, als sie sein sollten. Und sie haben gelogen, indem sie einen sogenannten Defeat Device, also eine Software, eingebaut haben, damit die Autos die Tests schummeln können. Und damit haben sie in allen Städten der Welt eigentlich sofort Umweltverschmutzung begangen. Und das ist wahnsinnig gefährlich für die Gesundheit. Also es ist für Menschen und Tiere und Natur ist das eine Katastrophe. Und sie wussten das. Das war ganz absichtlich und sie haben immer wieder gelogen. Und als sie dann ertappt worden sind, zum Beispiel von dem Mann von der Behörde, der Ermittler Alberto Ayala, mit dem ich gesprochen habe für das Buch, und ich erzähle die Geschichte durch seine Augen. Als Ermittler hat er gesagt: Ja, die haben mir jahrelang ins Gesicht gelogen. Und das will ich natürlich erstmal verstehen als Psychologin, weil Lügen, das haben wir schon viel erforscht. Und Erinnerung hängt natürlich dann auch damit zusammen, weil zum einen ja wurde man auch eh angelogen, aber dann kommt dazu, dass es so ein langer Skandal war, fast zehn Jahre. Und die Frage ist: Wer weiß wirklich noch, was da passiert ist? Also du meinst, zehn Jahre die diese Lüge gedauert hat? Die Lügen, die unterschiedlichen Informationen, dass die eigene Erinnerung vielleicht mal versagt oder sich ändert. Und da finde ich es auch einfach interessant. Ich frage Menschen in Deutschland immer wieder: Ja, was ist denn da passiert? Weil alle sagen: Ja klar, kennt man doch. Und da sage ich: Ja super, erklär mal. Und niemand hat mir bisher vollständig wirklich erklärt, was da passiert ist. Auch die, die ständig das irgendwie in den Nachrichten lesen und auch businessinteressiert sind, auch die können es nicht. Also deswegen fand ich es so wichtig, auch mit den Insidern zu sprechen für das Buch, weil sie verstehen es und sie wissen es und sie haben mit den Tätern selber gesprochen. Und kannst du was darüber sagen, was denn nun die VW-Mitarbeitenden dazu gebracht hat, an diesem Betrug, an diesen Lügen teilzunehmen? Also sie haben ja wohl, soweit ich weiß, finanziell nicht davon profitiert. Die Individuen nicht. Nee, also ganz oben könnte man sagen, gab es vielleicht Profit. Also klar, wenn jetzt der CEO großen Profit in Amerika macht und es hat ja super funktioniert, also die Autos haben sich gut verkauft, dann gibt es vielleicht Promotion, dann gibt es vielleicht mehr Geld. Aber es kann auch dazu führen, dass bei anderen Levels das natürlich nicht der Fall ist. Und das ist klar, man behält den Job, aber das heißt nicht, dass ich jetzt lüge und dafür sofort Geld kriege. Der Tausch ist nicht da. Und ich habe in dem Buch immer wieder mein sogenanntes Sechs-Säulen-Modell angewendet. Und hier habe ich auch gesehen, dass zwei vor allem dieser Faktoren, die Rationalisierung und die Konformität, ganz wichtig waren. Also die sechs insgesamt sind Bequemlichkeit, Straffreiheit, Gier. Da denkt ja jeder sofort dran. Ja, das stimmt. Das war auch meine erste Assoziation. Genau. Und dann Rationalisierung, Konformität und Verzweiflung. Und für mich ist ganz wichtig einfach, dass wir wirklich das ausarbeiten. Es ist nicht nur Gier. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube nicht, dass die Menschen, die bei VW gearbeitet haben, für die ging es nicht um Gier. Da ging es darum, dass sie entweder das rationalisiert haben: Ist es gar nicht so schlimm, andere Autos sind doch auch schlecht. Es gibt doch auch Flugzeuge, die sind noch schlechter als ich. Und das hat auch der New York Times Journalist, der damals zeitnah mit den Menschen gesprochen hat, weil er wollte einfach gucken, was passiert hier eigentlich gerade intern, was macht ihr. Und er hat auch gesagt, der Jack Ewing hat gesagt, dass die Menschen, die mit ihm gesprochen haben in Amerika, die haben immer wieder so 10 Prozent erklärt, was gerade schiefläuft oder was schiefgelaufen ist. Und 90 Prozent wollten ihm erklären, dass sie gute Menschen sind und dass es ja nicht so schlimm war, was sie da gemacht haben. Also diese Rationalisierung war immer wieder dabei. Und dann die Konformität. Dann wurde erklärt, alle anderen haben es auch gemacht und ich kann doch jetzt nicht einfach sagen: Nee, zu meinem Manager, das machen wir jetzt nicht. Und dann ist man auch in der Lüge drin. Und irgendwann das zuzugeben, ist dann auch schwer. Also das sind so die Faktoren, wo ich denke, das ist nicht pure Gier, das ist was anderes. Ja, spannend. Und welche Rolle hat denn das Klima gespielt in dem Zusammenhang? Also du hast gerade Jack Ewing angesprochen, Journalist. Mit dem hast du gesprochen über seine Recherche. Und er sagte, dass keiner seiner VW-Informanten ein schlechtes Gewissen hatte in Sachen Umwelt. Das fand ich auch sehr interessant. Das sind Emissionsingenieure. Das sind wirklich Menschen, die genau das studiert haben, was passiert, wenn ich jetzt Diesel verbrenne. Und ich finde das tatsächlich schwer nachzuvollziehen, dass man da einfach gar nicht wirklich an die Umwelt denkt. Oder denkt da auch wieder Rationalisierung: Ist ja gar nicht so schlimm im Vergleich zum Großen und Ganzen. Aber genau das hat er gesagt. Sie haben das einfach so zur Seite gesetzt, dieses Umweltthema, und fühlten sich dabei okay. Aber dazu muss man sagen, der Mann von der Behörde, von der Umweltbehörde, der halt das gecracked hat und herausgefunden hat, dass VW so lange gelogen hat. Er hat gesagt, dass er nach mehreren Jahren dann auf diesen selben Konferenzen war. Weil klar, man ist ja immer noch Ingenieur, man geht immer noch auf dieselben Konferenzen. Und er hat gesagt, es kamen Leute von VW auf mich zu und haben mir die Hand geschüttelt. Sie haben sich bedankt bei mir, dass ich diesen Fall ins Öffentliche gebracht habe, weil sie wollten das auch nicht machen. Und sie wussten nicht mehr, wie sie da rausfinden. Und das ist für mich auch so eine Story, die zeigt, wie wichtig unsere Umweltbehörden sind. Und ich verstehe gar nicht, warum wir nicht jeden Tag über unsere tolle Umweltbehörden sprechen. Weil Klimakrise und Umweltbehörde, die brauchen wir und die müssen wir auch zelebrieren. Also Fachleute, die sich kümmern und die da auch hauptberuflich reingucken. Genau. Und sie machen das ja jeden Tag, dass sie unsere Umwelt sauberer halten, dass sie Verantwortung für Unternehmen erzwingen, auch wenn es nötig ist. Und sie haben die Macht. Und das haben halt Aktivisten auf der Straße auch. Super, dass man für das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber die Regulatoren, beziehungsweise diese Menschen von den Umweltbehörden, die machen das schon. Die machen das jetzt in diesem Moment. Du hast gerade beschrieben, du hast dieses Sechs-Säulen-Modell entwickelt. Wie bist du da rangegangen? Wie hat sich das rauskristallisiert? Langsam. Ich habe drei Jahre an dem Buch geforscht. Und ich muss sagen, als Kriminalpsychologin, ich weiß nicht, ich wusste, das wird schwierig, weil es so große Themen sind. Also das war mir klar, dass es große Themen sind. Es war mir nicht offensichtlich, welche Cases ich auch sofort nehme, also welche Fälle und ich hatte auch eigentlich keine Kontakte in der Welt. Also Psychologie und Klima ist noch nicht so vernetzt. Und es gibt die Psychologists for Future zum Beispiel in Deutschland. Und das ist genau das, dass Psychologinnen sich das anschauen. Genau, an die hatte ich gerade gedacht. Genau. Und die gibt es, aber die gibt es zum Beispiel auch nicht in England. Die gibt es, glaube ich, nur in Deutschland. Aber ansonsten ist das noch nicht so vernetzt. Und meistens, wenn Psychologinnen über die Klimakrise sprechen, geht es eher darum, was hat es für eine Auswirkung auf den Menschen. Und so Klimaangst und Klimadepressionen. Und wie kann man das Messaging besser machen, damit das besser ankommt bei den Leuten. Und das ist auch absolut wichtig. Aber das ist was ganz anderes. Warum machen diese Täter das? Und jetzt gender ich ganz absichtlich nicht, weil es tatsächlich eigentlich nur Männer sind. Also ich habe auch wirklich gesucht nach Frauen, die Umweltverbrechen begehen. Und das ist ganz selten. Und da gibt es andere Faktoren. Es sind auch weniger Frauen Ingenieure etc. Aber die Fälle haben mich zu diesem Sechs-Säulen-Modell geführt, weil ich habe halt immer wieder mir diese unterschiedlichen Fälle angeguckt. Ich war auch zum Beispiel bei der UN Environmental Crime. Bei dem Kurs habe ich mitgemacht. Und dann habe ich an der Portsmouth University einen Kurs gemacht. Ich nehme immer an, ich weiß nichts. Also mache ich immer ganz viel Studiengänge dann wieder. Und dadurch hat sich dann so langsam herauskristallisiert. Also zwischen den Sanddieben und den illegalen Fischern und den F-Gasen und den bla bla bla. Es sind ja tausend. Es war immer wieder irgendwie dieselbe Struktur. Und daher kommt dieses Sechs- Säulen-Modell. Das habe ich selbst entwickelt und es ist angewandt eigentlich aus der Kriminologie. Spannend. Und ich will nicht zu tief auch schon dein Buch zu sehr vorgreifen, aber du hast auch einen Fall behandelt, da geht es um einen Auftragsmord um den Amazonas-Regenwald. Und ich würde einfach, wenn du es erlaubst, fragen: Wie sieht das Täterprofil in diesem Fall aus für dich? Oder was hast du für einen Eindruck da gewonnen? Ganz anders. Also immer noch das Sechs-Säulen-Modell ist relevant, aber die Täter an sich sind ganz andere. Weil bei Unternehmen also in dem Fall zumindest gab es keinen Mord. Ich habe auch zwei Unternehmensfälle von den sechs absichtlich auch in Anführungszeichen nur, weil ich wollte nicht immer wieder, dass es nur um Business geht. Und vier davon, da geht es halt um andere Themen. Und beim zweiten Kapitel geht es halt um diese Environmental Defenders, also die Umweltaktivistinnen, vor allem im Amazonas. Und da ist halt ein großes Thema, dass einige von diesen Aktivistinnen jedes Jahr ermordet werden. Und das ist richtig blutig. Also auch in dem Fall, über den ich schreibe, das ist der Fall von Maria und Siclaudio. Und das waren zwei Aktivistinnen und sie wurden ermordet auf ihrem gelben Motorrad. Sie waren gerade fahren auf einer Landstraße mitten im Amazonas in Pará. Das ist eines der gefährlichsten Orte im Amazonas. Und sie wurden attackiert. Da warteten zwei auf der anderen Seite von so einer kleinen Brücke. Und die sind wirklich aus dem Gebüsch gesprungen, ist jedenfalls die Vermutung, und haben sie dann mit einer Pistole einfach erschossen. Und dann ist halt das Zeichen von Auftragskillern in dieser Region, dass das Ohr abgeschnitten wird. Also haben sie sie ermordet. Sie waren auch noch nicht tot. Und dann haben sie ihm das Ohr abgeschnitten. Und das wissen wir, weil sie so gefunden worden sind. Da waren sie gerade tot. Aber es gab auch mehr Strafe für die Täter, weil sie sie nicht umgebracht haben, bevor sie das Ohr abgeschnitten haben. Also das war ganz klar, dass es ein Faktor war, das dann auch zur größeren Strafe geführt hat. Und bei dem Fall, was mich interessiert, ist der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Rechten der Natur. Und ich habe auch da mit einem Anwalt gesprochen, der Umweltanwalt ist und Menschenrechtsanwalt, tatsächlich beides. Und er bringt diesen Fall zusammen mit anderen Fällen zum International Criminal Court, also nach Den Haag. Und da geht es halt darum, dass es ein Menschenrechtsproblem ist, dass Brasilien nicht genug diese Menschen zur Strafe bringt, die zu sowas fähig sind. Aber da sind halt auch andere Faktoren. Also kann man sagen, das ist ja eigentlich ein normaler Mord. Also es ist jetzt kein Umweltverbrechen an sich, sie umzubringen. Das ist auch richtig. Aber sie haben sie halt umgebracht, damit sie das Land in Pará klauen können und abbrennen können und da Tiere hin tun können. Und deshalb kann man das nicht unterscheiden. Das ist nicht so einfach, dass man sagt, hier sind die Menschenrechten, da sind die Rechte der Natur. Man muss sie beide gleichzeitig behandeln. Also man packt sozusagen nicht diesen Hashtag Umweltverbrechen auf das Verbrechen, das passiert ist in einem Rahmen, der sich aber um Umwelt- und Klimaschutz und Natur dreht. Weil Menschen losgehen und die Natur schützen wollen und daran gehindert werden, indem sie getötet werden. Genau. Und auch ganz wichtig, was ja zum Glück auch immer wieder Thema ist in Diskussionen über das Klima, ist halt, dass indigene Menschen meistens bessere Wächter der Natur sind. Also wenn indigene Menschen auf Naturreserven wohnen, dann geht es meistens den Reserven besser. Das ist ganz bewiesen inzwischen. Und dass auch die Lebensart also halt schon der Glaube auch von ihnen. Sie wurden gefilmt vor ihrem Mord und das ist auch so krass. Er, der Siclaudio, hat einen TED Talk gegeben wenige Monate davor und hat gesagt: Ich werde wahrscheinlich ermordet. Und drei Monate später war er tot und genauso wie er es vorhergesehen hatte, genau wie er es vor Millionen von Menschen schon gesagt hatte. Also das ist auch so, das ist halt ein True Crime Fall auch. Ja, also dazu muss man ja auch wahnsinnig furchtlos und widerstandsfähig sein, sich dem auszusetzen und nicht einfach zu fliehen und zu sagen: Okay, hier steht mein Leben auf dem Spiel, ich höre hier auf. Genau. Und das könnte man ja sagen, hofft man, würde man auch tun, wenn Leute draußen stehen und drohen, das eigene Haus abzufackeln. Das ist ja bei denen der Fall. Und man könnte sagen, das ist bei uns allen der Fall. Jetzt muss man dazu sagen, unsere Erde ist es ja auch und unser Regenwald. Aber bei denen ist es noch näher, natürlich. Und da spreche ich auch über das Konzept vom psychologischen Eigentum und dass wir weniger psychologisches Eigentum haben meistens für den Amazonas zum Beispiel als Menschen, die halt dort wohnen. Aber dass man das kultivieren kann. Und da kommen halt diese psychologischen Aspekte immer wieder rein. Ich gehe halt immer wieder zurück zu dem Fall, aber dann gibt es so ein bisschen Pause, so einen Cliffhanger und dann Pause und dann geht es in die psychologischen Studien oder in die Geschichte der Idee. Also auch da, woher kommen indigene Rechte und wie verstehen, klar, das ist jetzt sehr homogen gedacht, aber insgesamt wer oder was ist indigen und was sind das für Glaubensarten, die uns vielleicht auch was beibringen können, beziehungsweise auch, wie sieht das dann in psychologischen Studien aus? Kann man Eigentum ändern und unsere Beziehung zu Eigentum ändern? Also dass uns sozusagen die Natur nochmal anders bewusst wird. Genau, also dass wir es nicht sehen als etwas, was wir nutzen sollten für uns oder ausnutzen sollten für uns, sondern auch wir sind Natur. Das ist eines der Sätze, das bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Wir sind nicht in der Natur, wir sind die Natur. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Ihr wollt 100 Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Jetzt hast du dir für das Buch viele weitere Umweltverbrechen angesehen. Du hast es schon gesagt: Überfischung, Wilderer, Umweltzerstörung durch die fossilen Konzerne. Und du hast im Laufe deiner Karriere auch mit den anderen Büchern schon in viele menschliche Abgründe geguckt. Musst du dich davon erholen und wie machst du das? Also vielleicht als Psychologin hast du dich wahrscheinlich selber schon durchschaut an ein paar Stellen. Wie gehst du daran, das wegzustecken? Es kommt drauf an. Also jede Woche ist anders, muss ich sagen. Ich arbeite auch als BBC-Präsenterin und arbeite da auch an True Crime-Fällen. Und es waren schon Momente, auch in diesem Buch, die ich schwer fand. Ich wollte es auch richtig machen. Das war auch was, mir schwer gefallen ist, weil das sind Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Das sind Menschen, die so tolle Arbeit machen. Und es war mir so wichtig, dass ich ihre Geschichten richtig erzähle. Und das fand ich tatsächlich noch schwieriger als die Fälle selbst dieses Mal. Natürlich, die Fälle selbst sind auch global und zukunftszerstörend könnten sie sein. Aber sie haben ja auch immer ein Happy Ending. Das war mir ganz wichtig, dass alle sechs Kapitel sind Beispiele von Fällen, wo ermittelt wurde, wo es Konsequenzen gab, sind Erfolge. Weil die müssen wir auch mal sehen. Und für mich hat das so komplett meine eigene Psyche beeinflusst, dass ich, ich weiß nicht, so im Feed sieht man ja nur die Dunkelheit. Niemand macht was und der Regenwald brennt und es ist ja alles negativ und da fühlt man sich sehr schnell sehr hilflos. Und so habe ich mich auch gefühlt. Du meinst bei Social Media? Genau, bei Social Media, aber auch in den Nachrichten insgesamt. Und das habe ich nicht mehr. Also ich fühle mich jetzt optimistischer als je, was die Klimakrise angeht, tatsächlich erstaunlicherweise. Hätte ich nicht gedacht. Aber weil es war eigentlich gedacht: Okay, ich will jetzt gucken, kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendwie aus der Psychologie, wenn ich mit Menschen spreche, können wir irgendwie irgendwas erreichen? Und ich wusste nicht, dass ich mich dann auch psychologisch besser fühle, aber das ist so passiert. Weil ich glaube, wenn man diese, ich weiß nicht, ob das jetzt ein doofes Wort ist, aber Helden so kennenlernt, das macht schon was Tolles mit einem, wo man sieht: Wir sind hier nicht alleine und guck mal, was wir alles schaffen. Und auch was es für Gesetze gibt und Agreements, multilateral Agreements zwischen Nationen. Es sind so viele Menschen, die gerade über dieses Thema denken und hart arbeiten, dass es eine bessere oder mindestens eine Zukunft gibt für uns. Und das ist inspirierend. Und ich hoffe, dass das auch die Auswirkung ist von dem Buch. Also klar, wird man zwischendurch wütend und klar, wird man zwischendurch denkt man: Oh, habe ich auch gedacht. Aber am Ende hoffe ich einfach, dass man so ein bisschen diese Armee hinter sich spürt und denkt: Nee, wir haben eine Chance. Gibt es irgendjemanden der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist von diesen Helden, Heldinnen, die du getroffen hast oder gesprochen hast? Alle sind bei mir hängen geblieben. Aber ich fand auch die Vedette Bester. Das ist eine klinische Soziologin und mit der spreche ich in Kapitel 5. Und Kapitel 5 handelt von dem illegalen Bergbau. Und sie hat halt, und das hat mich so inspiriert, als Soziologin hat sie sich entschieden, nicht nur, dass sie studiert, warum Menschen in den illegalen Bergbau gehen, vor allem arme Menschen, also so die Menschen, die wirklich in den Minen sind, nicht Menschen, die Gold kaufen von denen, die reingehen zum Beispiel, sondern wirklich die die unter der Erde sind. Und in diesen ganz problematischen, ganz gefährlichen Situationen auch. Also es ist so mein Albtraum, so in so eine alte Mine zu gehen, wo es dunkel ist und kaum Luft und es kann zusammenstürzen. Es ist für mich so… Ich bin gerade so einen ganz engen Turm hochgeklettert an einem Ausflug am Wochenende und es war so super schmal und der Rucksack ist schon so oben an der Kante gekratzt. Also allein dieses Gefühl von Enge, ne? Genau, das Gefühl von Enge. Und die bleiben auch Wochen oder Monate da drunter. Es gibt eine ganze Economy unterirdisch. Denen wird dann Sachen gebracht. Also da hat man dann so einen Tausch. Also das war für mich echt Albtraum. Aber sie wollte halt verstehen, warum Menschen in diese Situation gehen. Und was mich so inspiriert hat, ist, dass sie hat sich entschieden, sie wird jetzt einfach mal ihr Vertrauen gewinnen. Das ist ja auch nicht so einfach. Sie sind ja Straftäter. Also das wissen sie ja auch. Also da gibt es auch immer wieder juristische Konsequenzen für sie. Und sie hat halt gesagt, ich lebe halt einfach mal mit denen. Und sie ist dann da hingezogen in die Dörfer, wo sie gearbeitet haben und hat ganz langsam ihr Vertrauen gewonnen mit einer anderen Forscherin. Und am Ende, nach mehreren Jahren, hat sie dann erfahren, was wirklich die Faktoren sind, die sie da hinbringen. Und das muss man sich mal überlegen. Also dass man sich diesem Thema so annähert, wo viele eh schon sagen: Oh, das ist mir zu viel. Und sie sagt: Ja, aber ich will das jetzt so tief verstehen, dass ich da hinziehe. Das finde ich schon inspirierend, auch wieder, dass man als Wissenschaftlerin auch sowas machen kann. Ja, voll. Dein Buch ist ja im besten Sinne True Crime. Darüber haben wir schon gesprochen. Du hast es zum Teil… Im besten Sinne? Naja, also ich will damit sagen, du hast es ja schon angedeutet. Also True Crime ist ja oft auch so verschrien und oft auch so ein Durchschlüsselloch gucken und irgendwie sich weiß ich nicht, vielleicht daran ergötzen oder an dem Grusel. Weil ich… Ich weiß, dass es super beliebt ist, und ich habe es in einem anderen Podcast gehört, wie du beschrieben hast, dass es vor allen Dingen auch durch die Podcastszene so bekannt und berühmt geworden ist, überhaupt dieses Genre. Dass es so beliebt geworden ist durch „Serial“, den ersten weltbesten Podcast, über den wir alle vielleicht dahin gekommen sind. Aber jedenfalls hat es ja auch ein Geschmäckle. True Crime ist vor allen Dingen bei Frauen ein großes Thema. Und auf der anderen Seite hast du ja jetzt gerade auch schon dargelegt, dass deine Geschichten ein Happy End haben oder in irgendeiner Form auch die Entwicklung zeigen. Und deswegen sage ich im besten Sinne „True Crime“. Klammer zu. Und du hast es relativ auch reportagig angelegt. Wie war der Schreibprozess von diesem Buch? War der anders als bei den anderen davor, zum Beispiel? Ja, ganz anders. Also das war für mich auch ein Experiment und ein Grund, warum es mir so wichtig war, mich so in diesen True Crime-Stil zu steigern oder es zuzulassen, dass es auch so geschrieben wird. Was ich nicht gemacht habe in meinen vorherigen Büchern. Also ich mache viel True Crime als Podcasterin beim BBC zum Beispiel und auch im Fernsehen, aber halt noch nie geschrieben, also Langform. Und was ich wollte, was ich immer noch hoffe, ist, dass, wenn es so wie ein Krimi geschrieben ist, dass es mehr Menschen anzieht an diese Themen und in diese Welt. Diese Welthennen tatsächlich sogar, die vielleicht sonst es nicht gemacht hätten. Die vielleicht nicht über Stickoxide etwas lesen würden, die vielleicht nicht etwas über die EIA, die Environmental Investigations Agency, und die Undercover-Agenten, die da arbeiten, lesen würden. Die vielleicht nicht sich kümmern würden über illegales Fischen. Und ich glaube, das ist so meine Hoffnung, dass ich dadurch, dass ich es so erzähle, wie man es so ein bisschen dramatisch auch gewohnt ist, dass ich Menschen damit abhole woanders, die vielleicht sonst nicht unbedingt in diesem Thema sind. Das ist die Hoffnung. Ob es funktioniert, mal schauen. Aber der Schreibprozess, der war ganz anders. Ich habe so viel umgeschrieben. Ich habe so oft diese Kapitel umgeschrieben, und ein Grund war, dass es halt lange gedauert hat, bis ich die Kontakte hatte zu den Ermittlern. Und das hat man ja nicht, wenn man gerade neu auf der Szene ist. Und klar, ich habe jetzt schon ein paar Bücher geschrieben und ich hatte schon ein bisschen mehr Access. Du hattest schon einen Namen, oder? Ja, also das hatte ich schon, und das hat mir auch sehr geholfen, muss ich sagen. Und vielleicht auch die internationale Komponente als Deutsch-Kanadierin, oder? Ja, absolut. Also die Interviews waren alle auf Englisch, und genau das Internationale war wichtig. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber so diesen VW-Ermittler zum Beispiel, den habe ich wirklich so in der letzten Stunde noch bekommen, und ich habe komplett das Kapitel umgeschrieben, weil ich wollte einfach, dass jedes Kapitel durch die Augen der Ermittler ist. Und auch in Kapitel 4, bei den illegalen Fischern, das ist ja eine Verfolgungsjagd, richtig? Es ist ja, würde ich sagen, eins der aufregendsten Kapitel in dem Sinne, dass es so richtig auf dem Meer ist. Also 110 Tage durch die Antarktis, und es ist so richtig cool erzählt von dem Käpten, aber auch von dem Interpol-Agenten. Und bei dem, ich meine, ich habe seine WhatsApp. Also da gibt es keine Kontaktinformation im Netz. Ich habe mit ihm per Satellitentelefon gesprochen, da war er auf dem Meer, gerade aktiv, und hat da in Anführungszeichen Bösewächte gesucht. Das hat halt gedauert. Und dementsprechend sah der Schreibprozess ganz anders aus. Aber was mir ganz wichtig war, ist, dass es halt faktisch stimmt und auch, dass das, was dramatisiert ist, immer noch so nah wie möglich ist an der Realität. Und alles basiert auf echten Interviews mit echten Menschen oder halt Dokumenten, zum Beispiel die von Gerichtsprozessen stammen. Wie sieht denn dein Fazit aus? Was muss denn passieren, damit Umweltkriminelle keine Verbrechen mehr begehen? Oder kann es diesen Zustand überhaupt je geben? Ja, absolut. Also ich glaube, was ich erfahren habe, was mich auch sehr motiviert hat, ist, dass es ganz viele unterschiedliche Sachen gibt, die wir machen können. Also auch in dem Sechs-Säulen-Modell zum Beispiel. Bei Bequemlichkeit, da geht es halt darum, dass es einfacher ist, manchmal das Falsche zu tun als das Richtige. Und da kann man zum Beispiel auch Behörden hinschicken oder Ermittler hinschicken, die dann wirklich sagen: Hier gibt es eine Geldstrafe, wenn man es falsch macht. Und das kostet mehr, als wenn man es richtig macht. Und das ist halt das Wichtige, dass die Kosten und auch dieses Risiko, diese Kalkulation, dass sie halt stimmt. Und damit kann man schon mal viel machen. Dann Straffreiheit, klar, auch da Ermittler oder auch Menschen, die an Grenzen arbeiten, zum Beispiel. Weil ganz viele von diesen Sachen werden ja von einem Land zum anderen geschippt. Und da kann man ja auch handeln. Auch Anwälte können natürlich eingreifen. Gier ist etwas schwieriger. Aber auch Rationalisierung und Konformität, das sind psychologische Sachen. Und da kommt es darauf an, was man im Unternehmen oder im Syndikat macht. Also das kann auch bei organisierten Verbrechern gehen. Es geht ja auch um Normen und wie wir halt über vor allem Umweltverbrechen sprechen. Und das ist, was mich auch gerade so interessiert an diesem Gespräch über Öko-Zeiten. Und diese neuen Begriffe, über die wir gerade sprechen, da kommt ein neues Lexikon auf, das wir benutzen können, um auch klarzustellen, dass das für mich genauso wie andere Verbrechen ist. Die Umwelt zu zerstören, ist auf dem gleichen Level wie Gewaltverbrechen zum Beispiel. Und auch da schreibe ich ja auch. Ich habe mit einer amerikanischen Anwältin gesprochen, und da war großes Thema: Was machen wir mit Menschen, wenn wir sie jetzt fangen? Umweltverbrecher? Sollen die ins Gefängnis? Sollen sie nicht ins Gefängnis? Und das sind ja auch so Fragen. Und ich finde das alles sehr interessant. Ich glaube, an ganz vielen Stellen kann man wirklich viel erreichen. Klingt sehr hoffnungsfroh. Ist es auch. Das sagt die Kriminalpsychologin und Spiegel-Bestseller-Autorin Julia Shaw, die für ihr neues Buch „Green Crime“ Umweltverbrechen aus aller Welt analysiert und recherchiert hat. Vielen Dank für das Gespräch und dass du hier zu uns gekommen bist, zu detektor.fm ins Studio. Dankeschön! Sehr gerne, danke. Das war der Klima Podcast von detektor.fm für diese Woche. Lasst uns gern ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Damit sorgt ihr dafür, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden, die sich für unsere Themen interessieren könnten und uns eben noch nicht kennen. Ganz lieben Dank dafür! Die Redaktion für diese Folge hatte Marisa Becker und Audioproduktion Benjamin Serdani. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Ich bin Ina Lebetjev. Danke fürs Zuhören. Macht’s gut! Bis bald, tschüss! Der detektor.fm Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 % Ökostrom.
 Foto: Boris Breuer
Foto: Boris Breuer