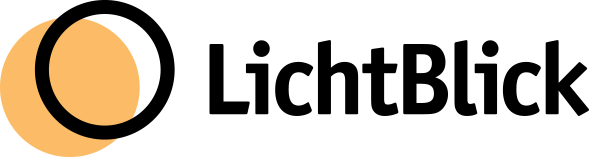Saubere Luft, ein gesunder Boden, frisches Wasser – das sind die Ressourcen, ohne die wir Menschen auf der Welt nicht existieren können. Aber was wenn wir nicht sorgsam genug mit ihnen umgehen? Der Energieverbrauch der Wasserwirtschaft soll sich bis zum Jahr 2040 mehr als verdoppeln, während der Wasserbedarf des Energiesektors um fast 60 Prozent steigen könnte. Das meldet das dänische Unternehmen Danfoss mit seinem Report „The Potential of the Water Energy Nexus“ und es schlägt Alarm. Darüber sprechen wir heute. Ihr hört den Klima Podcast von detektor.fm. Ich bin eure Host Ina Lebetjew. Schön, dass ihr zuhört. Mission Energiewende – der detektor.fm Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 Prozent Ökostrom. Wasser ist Leben, daran gibt’s keinen Zweifel. Und doch haben schon heute 3,6 Milliarden Menschen mindestens einen Monat pro Jahr keinen ausreichenden Zugang zu Wasser. Und auch in Deutschland ist die Wasserwirtschaft herausfordernd. Deshalb müssen wir auch hierzulande erkennen, an welchen Stellen Wasser- und Energiesysteme ineffizient arbeiten und modernisiert werden müssen, sagen Fachleute. Ich habe mit Thor Danielsen gesprochen. Er ist Global Water Development Lead beim dänischen Unternehmen Danfoss. Danfoss entwickelt Energie- und Klimatechnik Lösungen für eine effiziente Energienutzung und zur Reduzierung von Emissionen für Industrie, Verkehr, für Kälte-, Klima- und Heizungstechnik in Gebäuden. Vorab noch ein Hinweis: Das hier wird eine etwas ungewöhnliche Folge. Wir haben das Gespräch auf Englisch geführt, haben uns dann aber in der Redaktion dazu entschieden, es zu übersetzen, damit wichtige Details des Gesagten nicht verloren gehen. Ich werde zwischendurch ein paar Inhalte zusammenfassen und habe meinen Kollegen Tim Schmutzler gebeten, die Übersetzungen einzelner Originaltöne zu sprechen. Ausgangspunkt des Interviews war der Bericht von Danfoss zum Wasserverbrauch im Energiesektor. Ich habe Thor Danielsen gefragt, was in dem Papier drinsteht und zu welchen Erkenntnissen sein Unternehmen gekommen ist. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir derzeit tatsächlich in einer generationsübergreifenden Wasserkrise leben. Wir sehen, dass die Nachfrage nach Wasser im Jahr 2030 das Angebot um 40 Prozent übersteigen wird. Und wir sehen auch, dass die Energieerzeugung immer mehr Wasser benötigen wird. Dies wird ein limitierender Faktor für das Wachstum und für den Wohlstand unserer Gesellschaften sein. Und es geht auch um geopolitische Sicherheit. Wir bei Danfoss sehen, dass es eine Chance gibt, mit den bereits vorhandenen Technologien etwas zu tun. Es ist Zeit zu handeln. Es ist Zeit, sich die Wassersysteme anzusehen, die wir haben, und zu sehen, was wir schon heute damit tun können. Denn dieses Problem wird sich nur noch verschlimmern. Deshalb veröffentlichen wir dieses Papier, weil wir glauben, dass es bereits jetzt etwas zu tun gibt. Eine generationsübergreifende Wasserkrise, also eine Frage der geopolitischen Sicherheit. Das ist natürlich krass. Thor Danielsen hat mir als nächstes erklärt, dass es sich bei dem Bericht von Danfoss um die Forschungsarbeit eines Analyse-Teams handelt und nicht etwa um eine PR- oder Marketingaktion. Das Team hat für das Papier wissenschaftlich fundierte Zahlen ausgewertet, so Danielsen. Der Bericht soll ihm zufolge zeigen, dass es ein elementares Problem gibt, nämlich dass die Industrie sowohl der Wasser- als auch der Energiesektor Ressourcen verschwendet. Und Danfoss weist darauf hin, dass eine bessere Nutzung von bereits vorhandenen Technologien dazu beitragen könnte, sowohl Energie als auch Ressourcen zu sparen. Ich muss zugeben, dass ich das etwas abstrakt finde. Deswegen habe ich Thor Danielsen gebeten, mir Beispiele dafür zu geben. Ein klassisches Beispiel dafür ist, dass unsere Wasserleitungen undicht sind. Wenn man also Wasser aus Flüssen, Seen oder dem Boden pumpt und Energie und Ressourcen aufwendet, um es aufzubereiten und es dann an die Verbraucher weiterleitet, geht unterwegs etwas verloren. Weltweit gehen durchschnittlich zwischen 25 und 30 Prozent im System verloren. Das ist sauberes Wasser, das trinkfertig war. Das ist aber auch Energie, die dafür aufgewendet wurde. Und es sind auch Ressourcen in den Anlagen, also Pumpen und Gebäude und all diese Chemikalien, die zur Aufbereitung dieses Wassers benötigt werden und die einfach wieder in den Boden verloren gehen. Und wir wissen sogar aus Deutschland, dass es sehr gute Beispiele für Unternehmen, Wasserunternehmen gibt, die den Wasserverlust auf sechs, sieben Prozent senken konnten. Man kann also einen großen Einfluss auf die Welt haben. Abgesehen von diesem einen Beispiel, wie groß ist das Problem und wie wirkt es sich vielleicht schon jetzt auf unsere Ressourcen in der Zukunft aus? Nehmen wir zum Beispiel ein Land, das ich sehr gut kenne: Polen. In Polen gab es im Sommer 2018 eine große Dürre und die Pegelstände der Flüsse waren sehr niedrig. Hier bestehen also unterschiedliche Interessen: Landwirtschaft, Städte, Industrie und Energiewirtschaft beziehen ihr Wasser aus diesen Flüssen. Wer hat also Vorrang? Sollen wir die Stromversorgung unterbrechen, weil die Kraftwerke kein Kühlwasser mehr aus dem Fluss beziehen können? Oder sollen die Menschen in der Stadt auf Trinkwasser verzichten? Oder sollen wir die Bewässerung unserer Felder einstellen? Wenn wir kein Wasser in der Leitung verlieren, können wir bereits 25 Prozent des Wasserverbrauchs aller Städte entlang des Flusses einsparen. Und das könnten wir einfach aus der Gleichung herausnehmen, weil die Städte ihr Leitungssystem nachhaltiger und effizienter verwalten. Das würde beispielsweise mehr Spielraum lassen, um diese Dürreperioden zu bewältigen, die aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten werden. Thor Danielsen erklärt mir im Gespräch, dass Deutschland in Bezug auf Wasserverluste beispielsweise insgesamt recht gut abschneidet. Wenn man sich die Zahlen der Verbände der Wasserversorgungsunternehmen ansieht, sagt er, liegen sie im Durchschnitt unter 10. Es gibt jedoch einige Bundesländer und einige Regionen innerhalb dieser Bundesländer, in denen die Wasserverluste höher sind. Das Problem ist also nicht vollständig gelöst. Das Problem mit Wasser ist, dass es nicht wie Strom ist, stellt Thor Danielsen fest. Man könne nicht einfach eine lange Pipeline bauen und Wasser von einem Teil des Landes in einen anderen transportieren. Das ist viel zu teuer, erfordert Grabungsarbeiten und ist einfach nicht effizient, sagt er. Ein weiterer Aspekt, über den wir sprechen, ist unsere Abwasserbehandlung. Etwa 40 Prozent der Stromrechnung von durchschnittlichen Gemeinden entfallen auf die Abwasserbehandlung, erklärt mir Thor Danielsen. Und in Deutschland gibt es demnach viele ältere Anlagen, die seit vielen Jahren in Betrieb sind und nicht so optimiert sind, wie sie sein könnten. Wenn man zum Beispiel die Effizienzwerte einer der besten Anlagen nimmt, die er kennt, und den Durchschnitt aller Mitglieder des Deutschen Wasserwirtschafts- und Abwasserverbands heranzieht, ergibt sich ein Optimierungspotenzial von rund 30 Prozent. Man könnte demnach also ein Drittel der Energie, die in deutschen Kläranlagen verbraucht wird, einsparen. Und man müsste dafür nicht einmal komplett neue Kläranlagen bauen. Es geht darum, vorhandene Technologien zu installieren und sie besser zu steuern. Aber wie genau ist das möglich? Es ist eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. Und deshalb ist es etwas kompliziert, denn es erfordert, dass die Mitarbeiter der Anlagen über sehr fundierte Kenntnisse in Bereichen wie biologische Prozesse, mechanische Anlagen, Elektrizität und Energieerzeugung und all diesen Dingen verfügen. Aber im Wesentlichen hat man sein Abwasser, man pumpt es in ein System, wo es biologisch behandelt wird, man fügt etwas Luft hinzu, mischt es und pumpt es weiter. Manche würden sagen, man müsse nur eine effizientere Pumpe einbauen. Aber das ist nicht wirklich das Einzige. Man muss es auch auf eine bestimmte Weise steuern. Wenn man sich wahrscheinlich eines der besten Beispiele der Welt ansieht, die Kläranlage Marselisbo in Dänemark, dann sagt man, dass 70 Prozent der Energieoptimierung, die sie in ihrer Kläranlage vorgenommen haben, darauf abzielte, die biologischen Prozesse effizienter zu gestalten. Es geht also darum, wie die Pumpen arbeiten, wie man das Wasser mischt, wie lang lässt man die Biologie arbeiten, bevor man sie beispielsweise zur Erzeugung von Biogas nutzt, das man verbrennen und zur Stromerzeugung nutzen kann. Hier geht es also tatsächlich sehr viel um Digitalisierung, um Sensoren, Systeme, die Steuerung von Pumpen, Ventilatoren, Mischern und so weiter. Das Schöne daran ist jedoch, dass es nicht sehr teuer ist. Wenn man also weiß, wie es geht und es einrichtet, kann man die Investition oft innerhalb von 5 Jahren amortisieren. Very often have it pay back within 4 5 years. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Ihr wollt 100 Prozent Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostrom Anbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Wenn ich mir vorstelle, dass alle großen Städte in Deutschland, in Dänemark und in anderen Ländern Europas das gleiche Problem haben oder verursachen, nämlich dass sie einerseits Trinkwasser verschwenden und andererseits das Abwasser nicht so behandeln, wie es optimal wäre, dann ergibt sich da ganz naiv gesagt ein wirklich riesengroßes Problem. Und Thor Danielsen kann mir im Gespräch verdeutlichen, wie groß das Problem tatsächlich ist. Es gibt zahlreiche Studien zu diesem Thema. Nehmen wir zum Beispiel die Internationale Energieagentur, die 2018 eine Studie durchgeführt hat, in der es hieß: Was wäre, wenn man dieses erstklassige Beispiel von Marselisbo nimmt und jede einzelne Kläranlage auf diese Weise mit dieser Effizienz für die Kapazität bauen würde, die wir benötigen, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung im Jahr 2030 zu erreichen? Dann könnte man tatsächlich Energie in Höhe von 650 Terawattstunden pro Jahr einsparen. Das ist eine abstrakte Zahl, aber was bedeutet das? Zu diesem Zeitpunkt entsprach diese tatsächlich der gesamten Leistung aller Kohlekraftwerke in Europa. Das ist das globale Potenzial. Okay, krass. Aber wenn es so ein massives Potenzial gibt, Ressourcen zu sparen, und das auch verhältnismäßig einfach geht und von den Investitionen her nicht zu aufwendig ist, wie er sagt, warum wird das denn nicht längst überall gemacht? Thor Danielsen zieht das Beispiel Dänemark heran. Dort wurde gesetzlich festgelegt, dass man in seinem Verteilungssystem nicht mehr als 10 Prozent des Wassers verlieren darf. Wer diese Vorschrift nicht einhält, zahlt eine Geldstrafe. Also haben Unternehmen begonnen zu investieren, um unter diese 10 Prozent-Grenze zu kommen. Und so wurden Technologie, Know-how, Erfahrung usw. aufgebaut. Thor Danielsen sagt, es ist ein langsamer Prozess, außer es kommt zu einem schmerzhaften, einschneidenden Ereignis wie der Flut im Ahrtal in Deutschland im Sommer 2021. Dass es diese unfassbaren Überschwemmungen gab, bei denen mindestens 135 Menschen gestorben sind, das hat politische Maßnahmen in Gang gesetzt, sagt Danielsen, sodass wir in Deutschland inzwischen Frühwarnsysteme und Überwachungsmaßnahmen haben. Das sind Infrastrukturen, die man erst dann wirklich bemerkt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Man kann auch die große Überschwemmung in Kopenhagen im Jahr 2011 nehmen, die zu einer massiven Investitionsbewegung in Klimaanpassungen in Dänemark geführt hat. Aus irgendeinem Grund brauchen wir leider dieses schreckliche Ereignis, damit sich wirklich etwas bewegt. Und das sehen wir derzeit auch in Europa, wo die EU gerade eine Strategie zur Wasserresilienz eingeführt hat. Weil wir einfach erkennen, dass wir Wasser und auch die Energie rund um Wasser besser verwalten müssen, um eine resiliente Wirtschaft und eine resiliente Region zu haben. Das wird zu einer Frage der Sicherheitspolitik. Wir möchten Halbleiterfabriken ansiedeln, wir möchten in Bezug auf Rechenzentren unabhängig sein. All diese Branchen wollen wir nach Europa holen, aber sie verbrauchen sehr viel Wasser. Wie soll das also funktionieren, während Wasser zu einer immer knapperen Ressource wird? Halbleiterfabriken und Rechenzentren verbrauchen viel Wasser und viel Energie. Es sollten spezielle Anforderungen gestellt werden. Wie hoch ist die erwartete Energieeffizienz? Wie hoch ist der erwartete Wasserfußabdruck? Denn sonst könnten wir uns in einer unglücklichen Lage wiederfinden, in der wir im Ernstfall Prioritäten setzen müssen. Können wir die Arbeitsplätze und die Industrie wieder aufbauen? Können wir die Betriebe kommen, die wir geplant haben? Oder können wir landwirtschaftliche Produkte haben? Oder Städte? Oder die Stromversorgung in einer Region? Weil Wasser zur begrenzten Ressource wird. Auch in Südeuropa, Spanien und Italien zum Beispiel, ist das ein großes Problem, weil es dort so viel Dürre gibt. Dort wird massiv in Entsalzung investiert. Das heißt, Meerwasser wird in Süßwasser umgewandelt, das beispielsweise als Trinkwasser genutzt werden kann. Das ist eine sehr energieintensive Methode der Wassergewinnung. Aber da sie dazu gezwungen sind, tun sie es, um sicherzustellen, dass die Menschen weiterhin dort leben und die Wirtschaft aufrechterhalten können. Auch die Industrie arbeitet intensiv daran, herauszufinden, wie dies so energieeffizient wie möglich geschehen kann. Dies ist beispielsweise ein Bereich, in dem wir uns engagieren. Wir sind stolz darauf, dass wir an der Erreichung des Weltrekords für den energieeffizientesten Meerwasser- oder Umkehrosmoseprozess zur Umwandlung von Meerwasser in Trinkwasser beteiligt waren. Das Forschungsteam von Danfoss hat vier Punkte herausgearbeitet, die sie politischen Entscheidungsträgern mitgeben wollen. Zunächst sollen wir uns vor Augen führen, all das Wasser, das aktuell in den Boden gepumpt wird, kostet Geld. Das ist ein wirtschaftlicher Wert, den man einfach so verliert. Und deswegen sagt Thor Danielsen, geht es erstens darum, den Wasserverlust zu minimieren. Da müsse die Politik Ziele setzen. Und das geschieht schon, erklärt er mir beispielsweise auf EU-Ebene. Die EU-Trinkwasserrichtlinie sieht nun unter anderem vor, dass Wasserverluste überwacht, gemessen und transparent gemacht werden müssen. Da geht es natürlich um Investitionen in Technologie mithilfe von staatlichen Förderprogrammen, zum Beispiel. Das zweite Thema ist die Energieeffizienz in der Wasserpolitik. Da geht es unter anderem darum, bestimmte Mindestleistungsstandards für Kläranlagen zu fordern und zu prüfen, wie die Ziele erreicht werden können beziehungsweise warum sie aktuell noch nicht erreicht werden. Ein dritter Punkt: Anreize für die Digitalisierung. Ziel ist es sozusagen, mit weniger mehr zu erreichen. Das heißt, man hat eine sehr alte Infrastruktur und installiert einfach Sensoren und sogenannte Frequenzumrichter, mit denen man seine Anlage oder Infrastruktur besser steuern kann. Das spart Energie, Wasser, Ressourcen und Arbeitskräfte, was wiederum in Sachen Fachkräftemangel hilft, denn laut Danielsen ist es schwer, genügend qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Und viertens geht es darum, Wasser zu messen, zu zählen, zu tracken. Denn Thor Danielsen sagt, je knapper es wird, desto höher steigt der Wert des Wassers. Er findet, wir müssen herausfinden, wie wir besser mit dem Wasser haushalten und sparsamer damit umgehen können. Und wir müssen unsere Industrien dazu ermutigen, sich daran zu beteiligen. Das sind also die vier Punkte: Wasserverluste minimieren, Energieeffizienz in die Wasserpolitik integrieren, Anreize für die Digitalisierung schaffen und Wasser zählen lassen. Das sind die vier Dinge, die wir uns von den politischen Entscheidungsträgern wünschen. Zum Abschluss des Interviews stelle ich Thor Danielsen noch eine etwas persönlichere Frage. Wir haben zu diesem Zeitpunkt schon darüber gesprochen, dass Danfoss ein globales Unternehmen ist. Ich habe gelesen, dass dort weltweit mehr als 39.000 Menschen arbeiten. Danfoss hat Kunden in mehr als 100 Ländern und ebenso viele Produktionsstätten rund um den Globus. Da habe ich erst mich und dann ihn gefragt: Was macht eigentlich ein globaler Leiter für Wasserentwicklung, ein Global Water Development Lead? Wie sieht sein Tag aus? Das Schöne an meinem Tag ist, dass kein Tag wie der andere ist. Ich bin in einer sehr glücklichen Lage und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt zu Danfoss kommen wollte. Ich kann mit all den Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, die sich mit Wasser beschäftigen und mit ihnen darüber sprechen, wie wir die Probleme unserer Kunden, die mit Wasser und Abwasser arbeiten, wirklich lösen können. Dafür kann ich all das tun, was ich will. Ich kann sie informieren und dazu bringen, noch besser zu arbeiten. Ein Großteil meiner Arbeit besteht also darin, sicherzustellen, dass wir in den Regionen, in denen wir präsent sind und mit Wasser und Abwasser arbeiten, wirklich verstehen, wie wir mit unserer Technologie etwas bewirken können. Und das kann bedeuten, dass ich mit unseren Mitarbeitern spreche, die im Land unterwegs sind. Es kann bedeuten, dass ich mit Kunden aus anderen Ländern spreche, um zu wissen, wie wir unsere Kunden verstehen, womit sie zu kämpfen haben und wie wir ihre Probleme lösen können oder Produkte für sie noch besser machen können. Deshalb finde ich diesen Job fantastisch, weil man hoffentlich einen sehr positiven Einfluss auf die Welt haben kann, indem man mit etwas arbeitet, das jedem sehr am Herzen liegt: jedem Bürger und sogar jedem Tier auf dem Planeten und jeder Pflanze – Wasser und Abwasser, aber auch die Energie, die gebraucht wird, um es aufzubereiten und es den Menschen zur Verfügung zu stellen, sagt mir Thor Danielsen. Zum Schluss sind das etwas, das wir Otto Normalverbraucher oft übersehen. Und andererseits sagt er, gehen wir in eine Zeit des Klimawandels mit alternder Infrastruktur und Urbanisierung und all diesen Dingen, die unsere Systeme und unsere Umwelt verändern. Es wäre sinnvoll, dass wir Wasser und Energie in Zukunft nicht mehr so selbstverständlich hinnehmen wie bisher, findet er. Es gibt schreckliche Momente, in denen klar wird, dass wir vielleicht nicht so gut gearbeitet haben, wie wir dachten. Und dann fangen wir einfach an, zu schauen, was wir mit der vorhandenen Technologie machen können. Wir müssen keine Rakete bauen, die uns zum Mond bringt. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen es nur richtig einsetzen. Und genau darauf muss die Öffentlichkeit achten. Die Politik muss darauf achten. Die Industrie muss sicherstellen, dass sie die richtige Technologie liefern kann oder darüber verfügt. Dann können meiner Meinung nach gute Dinge geschehen. Das sagt Thor Danielsen. Er ist Global Water Development Lead beim dänischen Unternehmen Danfoss. Und das war der Klima Podcast von detektor.fm für diese Woche. Lasst uns gern ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Damit sorgt ihr dafür, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden, die sich für unsere Themen begeistern könnten und uns noch nicht kennen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ganz besonderer Dank geht diesmal natürlich ans Team Audio: Tim Schmutzler für die Overvoices und die Produktion dieser Folge. Und die Redaktion für diese Folge hatte ich, Ina Lebetjew. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Macht’s gut. Bis bald. Tschüss. Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 Prozent Ökostrom.
 Foto: Danfoss
Foto: Danfoss