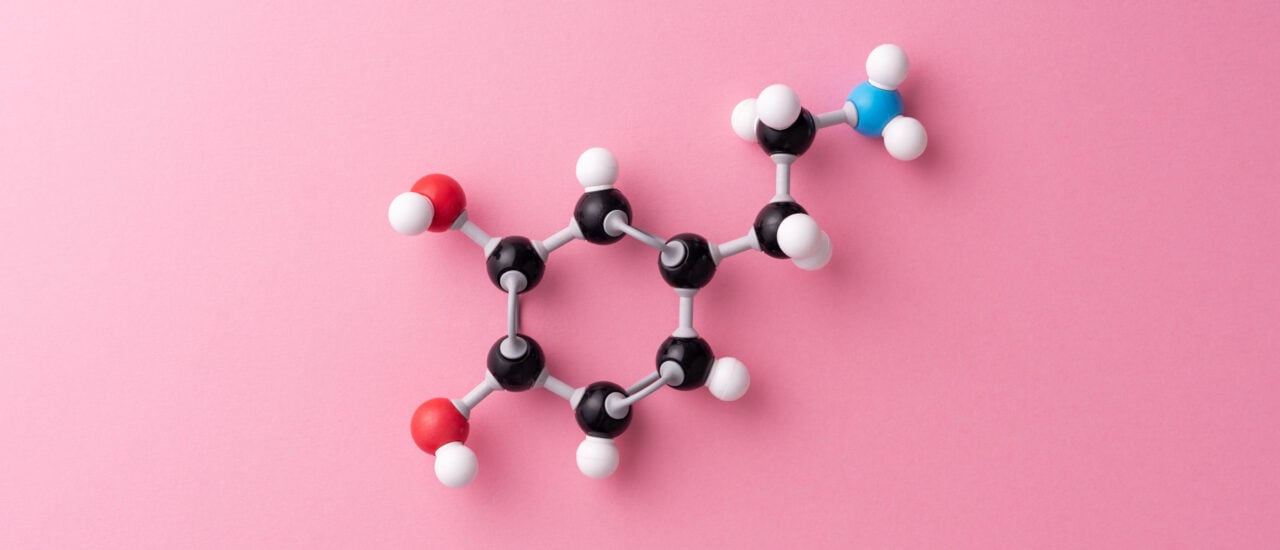Heute nehmen wir uns ein Molekül vor, das in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Superstar geworden ist – Dopamin. Kaum ein anderer Botenstoff des Gehirns hat so viele Mythen hervorgebracht. Aber was ist dran? Darum geht’s heute bei uns im Spektrum Podcast. Mein Name ist Max Zimmer, schön, dass ihr dabei seid. Spektrum der Wissenschaft – der Podcast von detektor.fm. Ja, ich hab einfach mal gegoogelt und Chet Chibiti auch gefragt, wie viele Pop-Songs es denn eigentlich gibt, in denen über Dopamin gesungen wird. Und die Liste ist wirklich lang. Da sind Künstlerinnen dabei von Billie Eilish, Miley Cyrus, Coldplay, Britney Spears und so weiter. Wirklich eine endlos lange Liste. Und immer dann, wenn Dopamin in den Texten dieser Lieder auftaucht, dann geht’s um Liebe, es geht um Rausch, um ein Gefühl des High-Seins und manchmal auch um Sucht und Selbstzerstörung. Dopamin, das ist also sowas wie der Popstar unter den Botenstoffen. Ich kenne jedenfalls kaum Lieder, in denen andere Botenstoffe besungen werden. Und es heißt ja auch oft, Dopamin ist dieses Glückshormon. Und dass unser Körper das ausschüttet, das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben: Sport, leckeres Essen, Musik zum Beispiel, aber eben auch Social Media, Pornos, Videospiele und Drogen. Dopamin wird deshalb gerne für alles Mögliche verantwortlich gemacht, von der Smartphone- bis zur Fastfood-Sucht zum Beispiel. Und auf Social Media habt ihr sicher auch schon gesehen, da gibt es sogar Ratgeber, wie man Dopamin fasten machen könnte. Forschende sagen aber, mit diesem simplen Bild vom Glückshormon, da ist Dopamin eigentlich nicht zu fassen. Es ist komplexer, es ist widersprüchlicher und in vieler Hinsicht überraschend. Und das Ganze hat sich Spektrum der Wissenschaft gerade mal genauer angeschaut. Und Redakteurin Lisa Bauer ist mein Gast, um darüber zu sprechen. Hallo Lisa. Hallo Max. Ja Lisa, fangen wir doch mal so an: Was ist denn Dopamin jetzt genau? Dopamin ist ein wichtiger Neurotransmitter. Und Neurotransmitter, das sind chemische Botenstoffe. Und die geben Reize von einer Nervenzelle zu einer anderen weiter. Und sie können sie auch verstärken oder abändern. Und so sind sie in der Lage, die Kommunikation im Nervensystem zu steuern. Und Dopamin ist ein Neurotransmitter. Es gibt mehrere andere auch noch. Und er wird im Mittelhirn hergestellt. Man weiß schon, dass er verschiedene Funktionen im Gehirn hat. Und die sind auch noch längst nicht alle verstanden. Und der Autor Theo Parker hat sich in der Gehirn- und Geistsausgabe vom August im Titelthema den vielfältigen Talenten und den falschen Annahmen rund um diesen Botenstoff gewidmet. Ja, und die Geschichte von Dopamin, die ist lang. Also ist schon lange bekannt. Wie hat man das denn entdeckt und warum ist es vielleicht auch lange unterschätzt worden? Es wurde ursprünglich schon 1910 entdeckt. Und man hielt es damals für die Vorstufe des Hormons Noradrenalin und hat es nicht weiter beachtet. Und zwar vier Jahrzehnte lang. Bis der schwedische Pharmakologe Arvid Carlsen in den 50ern etwas Interessantes beobachtet hat. Er forschte an einem Kaninchen und nachdem er ihren Dopaminfluss chemisch blockiert hatte, konnten die sich nicht mehr bewegen. Und die Lähmung ließ nach, nachdem er ihnen den Stoff L-Dopa gespritzt hat. Das ist ein chemischer Vorläufer von Dopamin. Carlsen hatte also einen echten Neurotransmitter entdeckt und dafür bekam er und seine Kollegen später den Nobelpreis. Ein Dopaminmangel hat bei Menschen übrigens ähnliche Folgen. Also bei Parkinson sterben vor allem Dopamin produzierende Zellen in der Substanz Nigra ab. Das ist eine Substanz im Mittelhirn. Und dadurch sinkt der Dopaminspiegel im Striatum. Das ist eine andere Region im Gehirn, auch in der Mitte des Gehirns. Und die ist für die Ausführung von Bewegungen entscheidend. Und L-Dopa hilft auch Menschen mit Parkinson und ist bis heute ein wichtiges Medikament gegen die Krankheit. Spannend, okay. Und wie kommen wir denn eigentlich zu dieser Sichtweise, dass Dopamin so dieses Glückshormon ist? Das hört man ja wirklich immer wieder. Wie ist das entstanden? Dazu hat vor allem ein berühmter Versuch mit Ratten beigetragen, der schon sehr alt ist, von 1954. Damals implantierten zwei Forscher, James Olds und Peter Milner, winzige Elektroden in das Gehirn von Ratten. Und wenn die Tiere einen Hebel drückten, dann konnten sie so eine Hirnregion ganz in der Mitte des Septums selbst mit Strom stimulieren. Und das taten die Tiere. Die drückten teilweise hunderte Male die Stunde auf diesen Hebel. Und ein Vierteljahrhundert später schlussfolgerte der Neurobiologe Roy Wise, dass Dopamin produzierende Zellen im Gehirn für diesen Effekt verantwortlich sind. So festigt sich der Ruf von Dopamin als Glückshormon. Aber inzwischen weiß man, dass das Bild des Glückshormons nicht richtig passt. Zum Beispiel haben Menschen mit Parkinson ja einen niedrigen Spiegel an Dopamin, aber sie können trotzdem Freude empfinden. Und Medikamente, die den Dopaminspiegel erhöhen, führen auch nicht zu starken Glücksgefühlen, sondern die haben ganz andere Nebenwirkungen. Zum Beispiel verhalten sich die Patienten eher impulsiv, sie gehen exzessiv shoppen oder sie verhalten sich sexuell unangemessen. Und heute weiß man, dass Dopamin eigentlich ausgeschüttet wird, wenn etwas Positives eintritt oder wenn wir etwas Positives erwarten. Es ist entscheidend für die Motivation. Es beeinflusst, wie sehr wir uns anstrengen, um etwas zu erreichen. Die Neurowissenschaftlerin Lineke Janssen, die zu Dopamin forscht, hat es so formuliert: dass nicht das Mögen, sondern das Wollen auf Dopamin beruht. Nicht das Mögen, sondern das Wollen. Genau. Wie wichtig ist Dopamin nun wirklich für uns? Oder habe ich gerade schon ein bisschen rausgehört, wird die Rolle vielleicht auch an Stellen ein bisschen falsch eingeschätzt oder übertrieben? Ja, es gibt ganz unterschiedliche dopaminerische Systeme im Gehirn, von denen man schon weiß. Eins habe ich schon erwähnt, das ist bei Parkinson betroffen und das führt von der Substanz Nigra zum Striatum. Das ist dieser Bereich, der für Bewegungen entscheidend ist. Und ein weiteres Dopaminsystem beginnt ebenfalls im Mittelhirn und zieht zum limbischen System und eins zum präfrontalen Cortex. Und das limbische System ist für Emotionen und fürs Lernen ganz entscheidend. Und der präfrontale Cortex, der hinter der Stirn liegt, ist ein Areal, das für höhere kognitive Funktionen zuständig ist, wie Planen und Problemlösen oder auch die Rolle von Impulsen. Und diese Pfade erklären so ein bisschen, warum die Funktion von Dopamin so vielfältig ist. Dopamin beeinflusst also, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir wahrnehmen und was wir erwarten. Und spielt eine große Rolle beim Lernen und auch bei der Entwicklung von Süchten. Also zum Beispiel setzt das Gehirn beim Konsum von Kokain Dopamin frei. Und nicht nur Laien und auf Social Media gibt es viele solche Annahmen um den Stoff. Auch Fachleute haben ihre Ansichten zum Thema Dopamin schon öfter korrigiert. Es hat schon angefangen, dass man bei der Entdeckung es erst mal falsch verstanden hat. Und es zieht sich auch so durch. Zum Beispiel glaubten in den 60ern die Fachleute, dass ein zu viel an Dopamin die Ursache von Schizophrenie sei. Und später entdeckte man dann, dass Menschen mit Schizophrenie in einigen Hirnarealen zu viel Dopamin haben und in anderen Hirnarealen haben sie zu wenig Dopamin. Und heute verfolgt man eine dritte Theorie. Man geht davon aus, dass Dopamin und andere Neurotransmitter bei der Entstehung von der Krankheit eine Rolle spielen, aber auch andere Faktoren wie Traumata und die soziale Umwelt. Das heißt, Dopamin taugt weder als Glückshormon noch als eine alleinige Erklärung für irgendeine psychische Störung bisher, wie Schizophrenie oder ADHS oder für Sucht. Aber Sucht und das Thema Kokain zum Beispiel hast du ja gerade schon angesprochen. Also oft werden Süchte ja mit Dopamin dann irgendwie erklärt. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört. Und jetzt habe ich bei euch gelernt, Forschende waren aber inzwischen so ein bisschen, ja, so einfach ist es dann vielleicht eben doch nicht. Du hast es gerade angeschnitten. Was hat es denn wirklich damit auf sich? Ja, in den 90ern entdeckte man, dass Dopamin hinter der stimulierenden Wirkung von Drogen wie zum Beispiel Amphetamin steckt. Und dafür nutzten Fachleute neue Verfahren wie die Positronen-Emissionstomographie. Und dabei kann man mithilfe von schwach radioaktiven Substanzen Stoffwechselprozesse im Gehirn sichtbar machen. Und das hat eben zu neuen Erkenntnissen geführt. Und man verstand das Zusammenspiel von Sucht und Dopamin immer besser. Kokainsüchtige besitzen zum Beispiel weniger Rezeptoren. Das sind die Andockstellen für Botenstoffe, für Dopamin im Striatum, diese Region, die ich schon mehrmals erwähnt habe. Und konsumieren Kokainsüchtige eine stimulierende Substanz, dann schüttet ihr Gehirn auch weniger Dopamin aus, als das bei Gesunden der Fall ist. Das heißt, das Gehirn reguliert nach vielen Dopaminschüben offenbar die Menge von Dopamin wieder herunter. Also das passt sich quasi an das, was passiert. Das könnte erklären, warum Abhängige mit der Zeit immer höhere Dosen benötigen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Das nennt man Toleranz-Effekt. Und solche Erkenntnisse haben Hoffnung geschürt, dass es so eine allgemeine Suchtformel gibt und dass man Süchtigen mit Therapien, die am Dopaminsystem ansetzen, auch schnell und effektiv helfen kann. Zum Beispiel hat Nora Volkow, eine führende Drogenforscherin, eine US-amerikanische Drogenforscherin, bei früheren Auftritten oft gesagt, bei Sucht dreht sich alles um Dopamin. Und mittlerweile ist auch sie da verhaltener, weil man gemerkt hat, so einfach ist es doch nicht. Es gibt zum Beispiel Medikamente, die lassen das Dopamin nach oben schnellen, aber ihr Suchtpotenzial ist eher gering. Zum Beispiel Ritalin. Und Medikamente, die die Konzentration von Dopamin erhöhen, wirken zum Beispiel bei Kokainabhängigen nicht besser als ein Placebo. Es ist also nicht so einfach und man kann Sucht nicht mit einem einzigen Botenstoff erklären. Auch andere Neurotransmitter spielen da eine Rolle und auch persönliche und soziale Probleme tragen eher einen Teil dazu bei. Und auch Nora Volkow betont inzwischen, dass zum Beispiel bei der Opioid-Krise in den USA, dass da auch Probleme im Gesundheitswesen und auf dem Wohnungsmarkt eine große Rolle gespielt haben. Also hat alles mehr Facetten als eben nur der reine Dopaminspiegel und die Ausschüttung davon. Es gibt, Lisa, inzwischen ja auf Social Media auch so eine Art Trend, der nennt sich so Dopamin Detox oder Dopamin Fasten, heißt es auch manchmal. Wie ist denn das zu betrachten? Also das ist ja quasi der bewusste Verzicht auf Dopamin dann? Genau, bei dem Trend will man das Gehirn von schädlichen Gelüsten befreien, indem man für längere Zeit Verlockungen entzagt, wie digitale Medien oder Süßigkeiten. Und oft ist davon die Rede, dass unsere Gesellschaft süchtig nach Dopamin sei. Dass Social Media, Pornos, Videospiele, dass das alles für schnelle Kicks sorgen würde und uns langfristig träge und lustlos macht. Und Dopamin Fasten oder Dopamin Detox soll dann der Ausweg daraus sein. Quasi ein millionenfach geklicktes Video auf YouTube, da formuliert es Improvement Pill, heißt er so. Der Sinn der Sache ist, so wenig Spaß wie möglich zu haben. Also wir sollen auf Smartphone, Social Media, Netflix verzichten, in extremen Fällen auch auf Freunde treffen, Bücher lesen, Musik hören. Und dadurch soll das Gehirn wieder ins Gleichgewicht kommen und sich von dem Botenstoff erholen. Und um diesen Hype ist ein regelrechter Markt entstanden. Und der erste, der diesen Begriff nutzte, war Cameron Sepper. Das ist ein Psychiater, ein US-Amerikaner, der hat den Begriff Dopamin Fasten in einem Blogbeitrag benutzt 2019. Und er war ziemlich überrascht, wie er sich verbreitet hat, dieser Begriff. Denn eigentlich ging es ihm gar nicht darum, Dopamin zu reduzieren. Und das stellte er später auch richtig. Das kann seine Methode eigentlich so gar nicht. Sondern er hat nach einem griffigen Titel für seine Methode gesucht und die auch offenbar gefunden. Und es ging ihm darum, ungünstige Verhaltensweisen zu erkennen und anzupassen. Im Prinzip eine Methode der kognitiven Verhaltenstherapie. Ja, und das klingt ja auch erstmal irgendwie ganz sinnvoll. Also wenn ich mir andere Fastenmodelle angucke, dann verzichte ich keine Ahnung, die Fastenzeit über auf Süßigkeiten und dann freue ich mich danach umso mehr nochmal über meine Schokolade oder so. Aber beim Dopamin muss man sagen, das schreibt ihr auch in eurem Artikel, ist es durchaus auch problematisch. Es ist wirklich keine Frage, es ist durchaus sinnvoll oder kann durchaus sinnvoll sein, wenn wir uns Auszeiten gönnen hin und wieder. Also wenn wir Stress abbauen, entschleunigen, im Wald spazieren, offline gehen oder zu festgelegten Zeiten nur auf Mails oder auf Smartphones schauen. Also es spricht überhaupt nichts dagegen. Und es spricht auch nichts dagegen, seinen Lebensstil und sein Verhalten immer wieder zu hinterfragen und potenziell schädliches Verhalten auch zu verändern und anzupassen. Problematisch ist dabei einfach, dass der Begriff irreführend ist und dass wir Dopamin brauchen. Er ist für uns lebenswichtig und wir können auch nicht süchtig nach ihm werden. Und es ist auch gar nicht möglich, den Botenstoff zu fasten, denn die Konzentration reguliert sich im gesunden Gehirn von ganz allein. Also wir brauchen quasi, um unser Verhalten zu ändern, erstmal nicht diesen Sündenbock Dopamin, dessen Rolle in solchen Verhaltensweisen auch noch überhaupt nicht gut ist. Denn anders als bei Drogen, die direkt an Rezeptoren im Gehirn andocken, ist es bei Verhaltensweisen nicht so. Deswegen weiß man auch noch viel weniger darüber, was genau bei bestimmten Verhaltensweisen im Gehirn passiert und auch noch weniger, was den Verzicht dann bewirkt. Es gibt schon Hinweise, dass Dopamin auch hier eine Rolle spielt. Zum Beispiel hat Lieneke Janssen, die Neurowissenschaftlerin, in der Studie Gehirn von Spielsüchtigen und Gesunden untersucht und sie hat entdeckt, dass in einem Teil des Striatums die Dopaminproduktion bei Spielsüchtigen tatsächlich höher war. Aber auch da ist unklar, was denn jetzt Ursache und was Folge ist. Also es könnte sein, dass ein verändertes Dopaminsystem Menschen anfälliger für eine Sucht macht. Oder es könnte sein, dass die Sucht mit der Zeit auch den Stoffwechsel im Gehirn verändert. Das lässt sich so nicht sagen. Okay, und wenn wir uns jetzt insgesamt anschauen, Dopamin wird dann so in der Popkultur, aber auch in diesen Ratgebern, die wir erwähnt haben, dann einfach oft falsch verstanden. Was würdest du sagen, oder bewusst falsch benutzt? Ich denke, es ist beides. Zum einen ist die Rolle von Dopamin ja sehr komplex und wenn wir vereinfachen, dann birgt es natürlich auch immer die Gefahr, dass etwas falsch wird. Aber gleichzeitig wird der Hype um Dopamin auch schon gezielt genutzt für eigene Interessen, um Geld zu verdienen, um Aufmerksamkeit zu bekommen und die eigene Agenda voranzutreiben. Und das passiert auch von Fachleuten. Und da ist es natürlich besonders problematisch, weil es schlechter zu erkennen ist, was jetzt quasi Forschung ist und was eigene Meinung. Und es gibt den Bestseller, die Dopamin Nation, der 1922 erschienen ist. Und da nutzt die Ärztin und Professorin von der Stanford University, Anna Lembke, zum Beispiel den Botenstoff für eine Gesellschaftskritik. Sie spricht davon, dass die heutige Welt eine Überfülle von schnellen Lockungen bietet und die halten uns von einem erfüllten Leben ab. Sie schreibt zum Beispiel, das Smartphone ist die moderne Injektionsnadel. Und sie warnt auch davor, vor Videospielen, Fast Food, Cannabis, Pornokonsum und prangert an, dass unsere Gesellschaft verweichlicht ist und süchtig nach billigen Dopamin. Wir alle riskieren, uns zu Tode zu erregen, schreibt sie. Und das ist ein verquerer Blick auf Süchte. Denn Menschen werden nicht abhängig, weil sie nach immer mehr Spaß suchen, sondern typisch für eine Sucht ist eigentlich, dass man Dinge wiederholt, die keine Freude mehr bereiten. Es ist also merkwürdig, wenn die Freude an Aktivitäten zum Problem erklärt wird. Denn Sucht entsteht nicht nur durch das Rauschmittel. In ihr zeigen sich tiefere Lebensprobleme. Denn sehr viele Menschen spielen Videospiele, essen Fast Food, schauen Pornos oder Serien, nutzen Social Media und nur ein Bruchteil von ihnen wird abhängig. Das heißt, es liegt nicht nur an der Substanz selber. Zum Beispiel zeigt eine Studie unter Neuntklässlern, dass nur rund ein Prozent für die Diagnose einer Computerspielsucht erfüllen. Und auch bei anderen Verhaltensproblemen oder Verhaltenssüchten sind die Zahlen sehr niedrig. Und entsprechend hat dann auch so ein gewisser Kurswechsel oder Blickwechsel in der Betrachtung von Dopamin stattgefunden, auch in der Wissenschaft. Abschließende Frage, Lisa: Wie blickt man denn dann heute auf dieses in Anführungszeichen Glückshormon? Eine vielversprechende Theorie ist die vom Reward Prediction Error. Die ist von Wolfram Schulz, ist ein deutsch-britischer Neuroforscher. Und auf Deutsch heißt die Theorie Fehler beim Erwarten von Belohnungen. Und er hat das Prinzip einmal anhand einer Anekdote erklärt. Auf einer Japanreise stand er vor einem Getränkeautomaten und weil er die Sprache nicht beherrscht hat, hat er einfach drauf gedrückt und bekam sein Lieblingsgetränk, Johannesbeersaft. Und beim nächsten Mal hat er wieder auf die gleiche Taste gedrückt und es kam ein anderes Getränk. Einmal quasi Freude, einmal Enttäuschung. Und solche Erwartungsbrüche sind wichtig, um Neues zu lernen. Davon geht er aus. Und Dopamin scheint hinter dieser Art des Lernens zu stecken. Das Mittelhirn schüttet besonders viel davon aus, wenn ein positiver Erwartungsfehler eintritt. Also wenn der unverhoffte Johannesbeersaft zum Beispiel erscheint. Bleibt eine Belohnung aus, dann sinkt der Dopaminspiegel kurzzeitig. Und interessanterweise feuern diese Dopaminzellen nicht erst beim Genuss, sondern auch schon vorher bei neutralen Reizen, die dem vorausgehen. Etwa wenn beim Automaten ein Licht blinkt. Das heißt, wenn etwas Positives wie erwartet eintritt, dann bleibt mit der Zeit der Dopaminschub aus. Süchte könnten die Schattenseite des Systems sein. Aufputschende Drogen täuschen dann quasi einen Erwartungsfehler vor, einen positiven, bringen das Belohnungslernen durcheinander. Aber auch die Theorie ist keine allesumfassende Dopaminformel. Und vermutlich wird man die auch gar nicht finden. Denn Dopamin kommt in mehreren Pfaden im Gehirn vor und es hat viele verschiedene Funktionen, je nachdem wo und wann es ausgeschüttet wird. Und statt nach der Suche nach der einen großen Theorie werben Forscher wie Lieneke Janssen zum Beispiel für ein anderes Bild. Dass man Dopamin als einen faszinierenden Botenstoff begreift, mit ganz vielen Facetten, quasi ein Alleskönner, ein Schweizer Taschenmesser im Gehirn. Und dieser Stoff, der wird die Fachwelt wohl auch in Zukunft immer wieder überraschen und so für den einen oder anderen Erwartungsfehler sorgen. Das mit Sicherheit ein faszinierender Botenstoff, sagst du. Und das ist es auf jeden Fall. Dopamin macht was mit uns allen und deshalb ist es umso interessanter, sich das anzuschauen. Ihr könnt das auf spektrum.de nochmal nachlesen oder in der Augustausgabe von Gehirn und Geist, dem Magazin für Psychologie und Hirnforschung von Spektrum der Wissenschaft. Und Lisa, dir sag ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Danke, Max. Ja, das war’s für diese Woche vom Spektrum Podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Wie immer am Freitag gibt’s dann eine neue Folge von uns. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und teilt. Das hilft uns sehr. Auch dafür vielen Dank. Mein Name ist Max Zimmer und ich sag Tschüss und macht’s gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm.