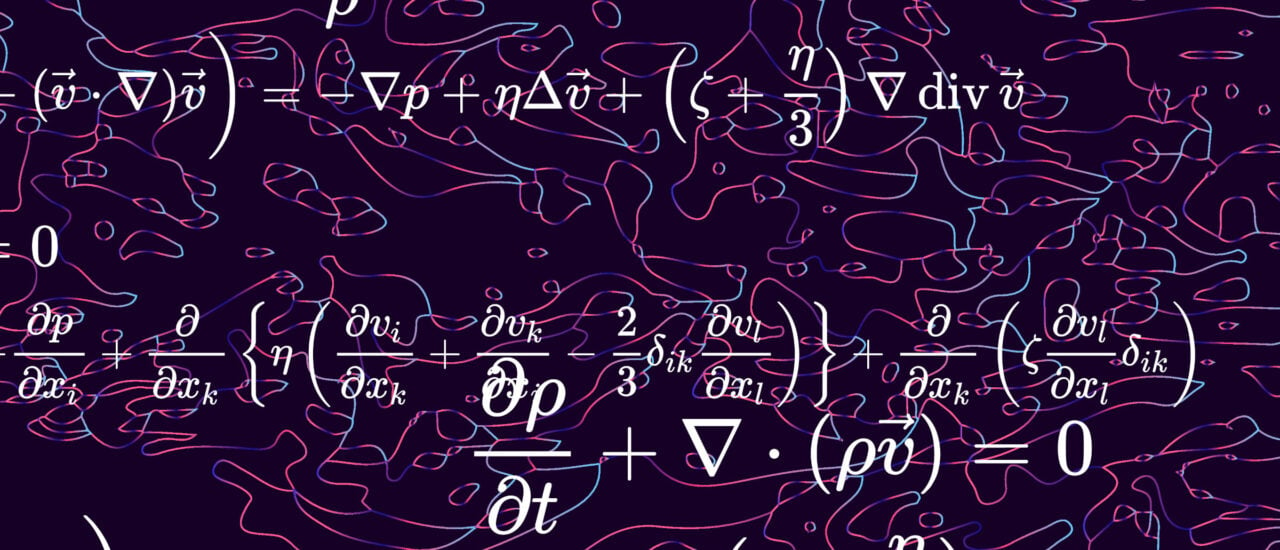Ob Wind, Wasser oder Blut – Strömungen, die sind überall um uns herum. Doch die sind wahnsinnig schwer zu berechnen. Die Gleichung dazu gehört zu den berühmten Millennium-Problemen der Mathematik. Und künstliche Intelligenz könnte uns vielleicht endlich zu einer Lösung bringen. Darum geht’s heute bei uns hier im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Max Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid. Spektrum der Wissenschaft – der Podcast von detektor.fm. Die sogenannten Millennium-Probleme, das sind sieben große Herausforderungen oder Rätsel, die als die wichtigsten offenen Fragen in der Mathematik gelten. Und eins dieser Millennium-Probleme hat mit Strömungen zu tun, also mit der Frage, wie sich Flüssigkeiten oder Gase bewegen. Das begegnet uns, ohne dass wir es merken, nämlich ständig im Alltag, immer dann, zum Beispiel, wenn wir es mit Wasser zu tun haben oder mit Luft. Also diese Strömungen, die bestimmen das Wetter, die beeinflussen Flug und Schifffahrt, die stecken hinter Turbinen und Motoren und spielen sogar in der Medizin und Biologie eine große Rolle. Blut zum Beispiel unterliegt ja auch diesen Gesetzen der Strömung. Man nennt diese Wissenschaftsdisziplin auch Fluiddynamik, und die hat’s echt in sich. Strömungen, gerade wenn Turbulenzen dazukommen, die sind super schwer zu berechnen. Die Gleichungen, die werden dann extrem komplex. Aber was genau ist jetzt das Problem eigentlich, und kann uns künstliche Intelligenz hier vielleicht weiterhelfen? Mit dieser Frage hat sich Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft gerade beschäftigt. Die ist Redakteurin für Mathe- und Physikthemen und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Manon! Hi Max! Ja, Manon, warum ist es denn überhaupt so wichtig, Strömungen gut berechnen zu können? Ja, also im Prinzip hast du eben schon gut aufgezählt: Fluide, das sind ja Gase und Flüssigkeiten, und die umgeben uns ja immer und überall. Und gerade wenn man zum Beispiel Tragflächen entwickeln möchte oder halt eben eine Pipeline irgendwo setzt, dann muss man wissen, wie die Fluide da drin strömen oder drumherum strömen. Und auch im Blutkreislauf, wenn man wissen möchte, ob eine Arterie verstopft wird oder so, dann braucht man solche Modelle, und dafür ist es sehr wichtig. Okay, und welche grundlegenden physikalischen Gesetze muss man denn jetzt kennen? Welche bilden die Basis, damit man diese Fluiddynamik verstehen kann? Ja, das sind die Navier-Stokes-Gleichungen. Also die beschreiben zum Beispiel, mit welchem Druck und mit welcher Geschwindigkeit ein Fluid sich in einer bestimmten Situation irgendwie bewegt. Also ein Fluid kann dabei auch zähflüssig sein, das heißt, es gibt so eine Art innere Reibung, also wie Ketchup, das nur ganz langsam aus einer Flasche kommt. Und die Gleichungen, die sind eigentlich schon seit rund 250 Jahren bekannt. Seit 250 Jahren, okay. Und ich habe aber eingangs gesagt, es ist ziemlich kompliziert, trotzdem die ganze Nummer. Was macht es denn so kompliziert, das Ganze zu berechnen? Also das sind Differentialgleichungen. Das heißt, die hängen nicht nur von normalen Variablen wie Ort oder Zeit ab, sondern da tauchen auch Ableitungen drin auf. Und solche Gleichungen sind halt eben extrem schwer zu lösen. Oft gibt es auch keine allgemeingültige exakte Lösungsformel für Differentialgleichungen, und auch in diesem Fall nicht. Also die Navier-Stokes-Gleichungen, da kannst du nicht schreiben: „Das ist die Lösung“, und dann setze ich da einfach nur den Druck ein und den Ort und den Zeitpunkt, und dann weiß ich, wie genau an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt der Fluss fließt. Sondern man ist halt in dem Fall wirklich einfach nur auf Näherungslösungen angewiesen, die mit Computerverfahren ausgerechnet werden. Das heißt, für ganz bestimmte Spezialfälle kann man eventuell schon noch eine exakte Lösung bestimmen. Also zum Beispiel, wenn man eine ideale Flüssigkeit hat, die ohne innere Reibung in einem ganz geraden Rohr gleichmäßig fließt. Da wird man wahrscheinlich die Lösung beschreiben können. Aber sobald man die Situation ganz leicht abändert, also zum Beispiel auch eine kleine Turbulenz oder so drin ist, ja, dann werden die Gleichungen unlösbar. Turbulenzen ist ein wichtiges Stichwort. Da gehen wir gleich noch ein bisschen darauf ein. Ich habe eingangs gesagt, das hat was mit diesen berühmten Millennium-Problemen zu tun. Hat der eine oder die andere bestimmt schon mal gehört. Das ist immer wieder auch in den Medien, wenn da sich eine Lösung andeutet. Worin genau besteht denn jetzt dieses Millennium-Problem, wenn wir uns Strömungen anschauen? Also die Millennium-Probleme, vielleicht erst mal um das zu erklären, die wurden im Jahr 2000 ausgerufen. Das sind ausgewählte mathematische Fragestellungen, die die Forschung des 21. Jahrhunderts prägen sollen. Und das hat in der Mathematik irgendwie auch Tradition, weil David Hilbert, also das ist so der Mathematiker, im Jahr 1900 23 wichtige Probleme vorgestellt hatte. Und die waren halt sehr prägend für das 20. Jahrhundert. Und naja, da hat man halt gedacht, im Jahr 2000 könnte man dasselbe auch noch mal machen, diesmal für sieben hartnäckige Probleme. Und für deren Lösung kriegt man halt je eine Million US-Dollar. Das ist auch schon mal ganz nice, kleiner Anreiz, um sich damit zu beschäftigen. Genau. Und nur um so viel zu sagen: Es sind jetzt 25 Jahre vergangen, und es gab etliche Bemühungen, eben gerade auch wegen dem Preisgeld, um die Millennium-Probleme zu lösen. Und bisher wurde nur ein einziges geknackt, und Navier-Stokes ist es nicht. Also das Navier-Stokes-Problem dreht sich um die Frage, wie sich die Lösungen der Gleichungen verhalten. Also so ganz abstrakt ist es klar, es gibt keine exakte Lösung, aber die Frage ist: Können die Lösungen vielleicht explodieren? Und damit meint man, dass zum Beispiel von einem Moment zum anderen auf einmal gigantische Werte rauskommen. Also das heißt in dem Fall, dass sie von einem Moment zum anderen zum Beispiel gigantische Werte ausspucken oder abrupt null werden. Also das entspricht dann zum Beispiel einer Flüssigkeit, die sich plötzlich unendlich schnell dreht oder halt einem Fluss, dessen Strömung plötzlich anhält und dann wieder weiterläuft. Oder halt einer ruhenden Flüssigkeit, die plötzlich turbulent wird. Und all das hat man noch nie beobachtet, aber trotzdem will man wissen, ob die Gleichungen solche Lösungen bergen könnten. Und ja, seit 250 Jahren wird danach gesucht. 250 Jahre, das ist schon auch echt heftig. Aber es ist ja total blöd. Man hat ein Problem, was man nicht lösen kann, man will es aber unbedingt lösen. Wir haben ja auch gehört, warum das wichtig wäre. Wie geht man denn bisher damit um? Also Fachleute gehen davon aus, dass solche explodierenden Lösungen existieren könnten. Und zwar, weil in vereinfachten Versionen der Navier-Stokes-Gleichung hat man eben schon solche explodierenden Lösungen gefunden. Und also wie man dabei vorgeht, ist: Man sucht nach geeigneten Situationen, in denen diese Lösungen auftreten könnten. Also man sucht das passende Fluid mit der passenden Umgebung und der passenden Geschwindigkeit und guckt dann: „Hey, wird irgendein Wert vielleicht auf einmal unendlich groß?“ Und dann nutzt man halt eben diese Computerprogramme, die Näherungslösungen der Gleichung berechnen können. Und wenn man dann halt sieht: „Oh ja, stimmt, guck mal, dieser Wert wird wirklich immer größer.“ Also ich meine, ein Computerprogramm wird ja niemals unendlich ausgeben, aber man sieht: „Oh, auf einmal wird es irgendwie gigantisch.“ Dann nimmt man sich diese Situation nochmal wirklich mathematisch vor, schaut das nochmal an und zeigt: „Okay, das hier geht wirklich gegen unendlich.“ Und es ist auch wirklich eine Lösung der Gleichung, die ich gerade betrachte. Also diese zwei Sachen müssen dann nochmal per Hand quasi gemacht werden. Und bislang hat man das aber noch nicht für die Navier-Stokes-Gleichung zeigen können. Und eine der Hauptschwierigkeiten ist dabei, dass man überhaupt erst mal so geeignete Kandidaten, also geeignete Situationen finden muss, die halt überhaupt explodieren könnten. Okay, also soweit mal zum Status quo, der nicht zufriedenstellend ist für Mathematikerinnen und Mathematiker. Und du hast dich gerade mit Forschung befasst, die da vielleicht einen entscheidenden Fortschritt gemacht hat, oder? Also erklär mal, was haben die gemacht? Was hast du dir da angeschaut? Also tatsächlich war es jetzt auch Zufall, dass ich darauf gestoßen bin, weil ich war auf einer Konferenz in Heidelberg, am Heidelberg Laureate Forum, und ich hatte vorher gesehen, dass Javier Gomez Serrano dort zu Gast ist. Und ich wusste, dass er schon vor ein paar Jahren an dem Problem gearbeitet hatte und damals, 2023, glaube ich, einen großen Fortschritt gemacht hatte. Und dann habe ich gedacht: „Hey, cool, wenn er schon mal vor Ort ist, dann schnapp ich mir doch mal für ein Interview.“ Und so läuft das übrigens im Wissenschaftsjournalismus: Man geht auf eine Konferenz und schnappt sich die Leute mal kurz. Ja, genau. Ist auch nicht immer so einfach, aber er war einfach zu schnappen. Und dann hat er mir gesagt, dass er erst mal noch nicht so viel sagen kann, aber in zwei Tagen ein wichtiges Paper rauskommt, ein neues, und er dann mit mir sprechen kann. Und glücklicherweise ging die Konferenz noch zwei Tage später, und ich war auch noch da. Und dann habe ich ihn mir nochmal geschnappt. Tatsächlich hat er mich aber auch gesucht, um mir davon zu erzählen. Und da hat er mir von den neuesten Ergebnissen erzählt. Und zwar arbeitet er mit weiteren Mathematikern noch und Google DeepMind zusammen. Also Google DeepMind entwickelt KI-Programme, und die nutzen eine KI, um nach möglichen Kandidaten eben für diese explodierenden Lösungen zu suchen. Und dafür haben die ein neuronales Netz verwendet. Also darüber haben wir schon ein paar Mal, glaube ich, gesprochen. Das ist quasi eine Software, die an unser Gehirn angelehnt ist, und so vom Aufbau her oder von der Wirkweise. Ja, genau. Vom Aufbau her wie der visuelle Cortex funktioniert für die Neurowissenschaftler unter uns. Und dieses neuronale Netz haben die halt eben noch mit physikalischem Wissen angereichert. Also haben dem zum Beispiel sowas gesagt wie: „Energie muss erhalten bleiben“ und noch ein paar andere Sachen über die Navier-Stokes-Gleichung und Fluiddynamik. Und so konnten die jetzt erst mal systematisch nach explodierenden Lösungen suchen. Und die wurden auch fündig. Also sie haben mehrere Kandidaten gefunden. Aber Achtung, Achtung: nur für vereinfachte Versionen der Navier-Stokes-Gleichung, aber für Versionen, für die das noch nicht klar war, ob es solche Lösungen gibt. Und damit ist es halt wirklich ein enormer Fortschritt, weil das halt bisher noch nicht möglich war. Vor allem, man konnte nicht systematisch danach suchen. Also wenn man solche Lösungen gefunden hatte, war es eher so ein Zufallsfund. Und vor allem, noch mal um ein bisschen technischer zu werden: Die haben sich instabile explodierende Lösungen angeguckt. Das sind solche, die sofort wieder verschwinden, wenn man die Situation so leicht abändert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Strudel finde, der explodieren würde, also sich auf einmal unendlich schnell dreht, wenn der nur so ganz leicht gestört wird, dass er sich so einen Nanometer bewegt oder so, dann würde diese Unendlichkeit wieder verschwinden. Und instabile Lösungen kann man halt in der Natur natürlich nie beobachten, weil man immer von der Umgebung irgendwelche Störungen hat, sodass das gar nicht erst entstehen könnte. Also man könnte das nicht beobachten, weil es würde so ganz schnell wieder vorbei. Und genau deswegen findet man die aber so interessant, weil ich habe ja schon gesagt, eingangs, man hat noch nie so explodierende Lösungen irgendwie beobachtet. Das könnte aber auch einfach daran liegen, dass die alle instabil sind und deswegen genau gar nicht auftauchen können. Und es ist jetzt wirklich das erste Mal, dass es einen systematischen Weg gibt, um nach instabilen explodierenden Lösungen zu suchen. Und das hat halt eben die KI ermöglicht. Ja, KI, wir hatten das neulich schon mal auch. Es wird immer wichtiger in vielen Forschungsbereichen, aber eben auch in der Mathematik. Ist es so? Mir kommt es vor, als wäre das gerade auch wirklich exemplarisch, dass immer eine stärkere Rolle auch von KI ausgeht, gerade auch in Mathe. Ja, also in den Medien wird da sehr, sehr viel von gesprochen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass die Meinungen darüber sehr geteilt sind. Also viele Forscherinnen und Forscher sagen, dass in ihrer alltäglichen Arbeit KI noch keine Rolle spielt, auch gerade Mathematikerinnen und Mathematiker. Aber das kann auch daran liegen, dass sie damit vielleicht noch nicht so vertraut sind oder vielleicht noch nicht wissen, wo sie es einsetzen können. Also das sagen zumindest die KI-Enthusiasten. Also man kriegt da auf jeden Fall echt zwei ganz verschiedene Bilder gezeigt. Und ich war jetzt auf dieser Konferenz, habe ich ja gesagt, auf diesem Heidelberg Laureate Forum, und da wurde auch sehr, sehr viel über KI und KI in der Mathematik gesprochen. Und auch dort war die Meinung nicht ganz einhellig. Also die Zuhörenden, sage ich jetzt mal, die auch eher junge Forscherinnen und Forscher waren, also angehende Mathematiker, die sich ja noch erhoffen, eine große Rolle als Menschen in der Mathematik zu spielen, die waren dann nicht ganz so begeistert, als viele KI-Enthusiasten auf der Bühne waren und meinten, dass vielleicht bald schon KI die Mathematik komplett übernehmen wird. Also dann sowohl eine Vermutung aufstellt, weil KI ist ja kreativ und kann ja Muster erkennen. Also könnte sagen: „Das sieht doch so aus, vielleicht gibt es ja immer diesen Zusammenhang.“ Dann KI auch noch diese Vermutung am Ende beweist. Dann haben wir ja in der letzten Folge mal über Beweisprüfer gesprochen in der Mathematik, das heißt Computer, die halt wirklich systematisch checken: „Hey, dieser Beweis ist korrekt.“ Und dann am Ende die KI noch das Paper schreiben, veröffentlichen. Und dann fragt man sich: „Wofür braucht man dann noch den Menschen?“ Also das ist jetzt wirklich die extreme Sichtweise, die bei Weitem nicht alle vertreten. Aber das wurde tatsächlich auf der Konferenz auch besprochen, dass das vielleicht so sein könnte und dass der Mensch auf einmal nur noch die Rolle hat eines kommentierenden Wesens. Also wie wenn man Shakespeare bespricht und kein Shakespeare mehr selbst schreibt, aber halt eben immer noch darüber Facharbeiten veröffentlicht. Das ist spannend, weil ja oft auch gerade in den letzten Jahren darüber gesprochen wird, welche Berufe vielleicht obsolet werden. Und irgendwie da gehen so Dystopien um oder Ängste. Ja, wer alles arbeitslos wird wegen KI. Aber ich hatte Mathematikerinnen und Mathematiker bisher gar nicht auf dem Zettel, dass die sich vielleicht auch Gedanken machen könnten. Ja, ist jetzt auch nicht das größte Berufsfeld, sage ich jetzt mal. Aber ja, tatsächlich. Also das wurde auch gesagt in der Konferenz, dass man auch oft sich sehr verschätzt hat, was für Aufgaben eine KI am Ende besonders gut erledigen kann und was nicht. Also gerade kreative Berufe oder so hätte man ja gedacht: „Naja, das wird ja eine KI nie machen.“ Aber jetzt merken wir: „Naja, so unkreativ ist die ja gar nicht am Ende.“ Und das ist ja irgendwie dann doch erschreckend. Die Frage ist halt, was will man denn abgeben an Aufgabentätigkeiten? Was kriegt man dafür? Wenn man mehr Freizeit dafür kriegt, ist ja vielleicht auch okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, also nach allem, was du jetzt gesagt hast, wie nah sind wir denn jetzt mit dieser neuen Forschungsarbeit und auch dem Einsatz von KI einer Lösung dieses Problems bei den Strömungen gekommen? Und wie geht es jetzt vielleicht auch mit der Forschung daran weiter? Also Javier Gomez Serrano, also der, mit dem ich gesprochen habe, und seine Kollegen, die arbeiten jetzt auf jeden Fall weiter daran, mit DeepMind auch um den Ansatz zu verfeinern, weiterzuentwickeln, damit sie halt eben auch die Navier-Stokes-Gleichung nach instabilen explodierenden Lösungen absuchen können. Bislang gilt ihr Ansatz auch in der Community als sehr vielversprechend. Also ich habe auch mit anderen Forschern gesprochen, die nicht daran beteiligt waren, die sagen: „Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was sie da machen.“ Aber es ist halt noch weit weg vom Millennium-Problem an sich. Also da müssen sie schon noch große Hürden überwinden. Aber es ist halt einfach ein wichtiger neuer Schritt. Und es gibt auch viele Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, sie können sich schon vorstellen, dass dieses Millennium-Problem von einer KI gelöst wird. Vielleicht sogar. Wer kriegt das Preisgeld? Dann ist die Frage natürlich: Die KI kann damit wenig anfangen. Stand jetzt, genau. Okay, und dann würde ich zum Schluss auch gerne noch mal auf die Frage eingehen: Vielleicht haben sich das einige gefragt, was hat das mit mir zu tun? Aber wir haben es ja am Anfang so ein bisschen angedeutet, in welchen Bereichen diese Strömung und das Wissen darüber auch eine Rolle spielen können. Also zum Schluss noch mal die Frage: Warum ist das für uns relevant, auch in Zukunft? Ja, also wir haben die vielen Anwendungsgebiete angesprochen. Es war aber auch ein bisschen fies, ehrlich gesagt, weil wenn wir die Antwort auf das Navier-Stokes-Problem wissen, also zum Beispiel, dass es diese instabilen explodierenden Lösungen gibt, dann ändert das für unseren Alltag genau gar nichts. Erstmal. Sorry, hab’s befürchtet. Und auch Gomez Serrano hat gesagt: „Naja, es werden jetzt keine Flugzeuge vom Himmel fallen, wenn wir das wissen.“ Nee, natürlich nicht. Und das Ding ist aber, dass diese Fragestellung halt für Mathematiker und Mathematikerinnen super relevant ist, weil es halt da um Differentialgleichungen geht. Und Differentialgleichungen beschreiben einfach alles, was sich verändert, also gerade auch in der Physik halt relevant sind. Also da würde man dann auf jeden Fall viel lernen. Und ja, ich finde auch diese Bedeutung einfach, wenn wirklich ein Millennium-Problem am Ende mithilfe von der KI gelöst werden würde. Es wäre ja mithilfe von der KI. Da sind ja schon noch viele Menschen, die sehr viel Hirnschmalz reinstecken. Und man braucht ja, also wie gesagt, KI macht einen Teil dieser Arbeit. Aber zumindest, Stand jetzt, müssen die Menschen das ja dann auch immer noch von Hand zeigen oder nutzen auch Computer, aber normale Programme in Anführungsstrichen. Es wäre aber trotzdem ein Wendepunkt. Und es würde halt auf jeden Fall zeigen, dass KI eine neue Art von Werkzeug ist, die halt wirklich eine große Relevanz in der Spitzenforschung auch hat in der jetzigen. Weil es gab schon Matheergebnisse mithilfe von KI, aber das waren entweder nicht so wahnsinnig relevante Ergebnisse oder es war: „Ja, man hat KI so ein bisschen eingesetzt und hat irgendwie was Interessantes gefunden.“ Aber so einen richtigen Durchbruch mit KI gab es noch nicht. Und ja, das könnte sich jetzt vielleicht bald ändern. Und das könnte auch für so ein Umdenken in der Community sorgen, dass halt Mathematiker auch sehen: „Hey, cool, diese KI-Methoden, was kann ich vielleicht damit in meinem Forschungsbereich machen?“ Und vielleicht ist es ja ein hilfreiches Werkzeug, auch jetzt schon. Ja, also ich finde, man sieht die Schlagzeilen ja auch schon vor sich. Das wäre ein Meilenstein, wenn man sagen würde: „Eins dieser großen mathematischen Millennium-Probleme, eins davon wurde mithilfe von KI gelöst.“ Klar, ja, ich sehe auch den Spektrum-Titel schon vor mir. Ja, da wirst du dann wahrscheinlich drüber schreiben. Okay, mehr dazu erfahrt ihr ja auch bei Spektrum der Wissenschaft, nämlich auf spektrum.de könnt ihr Manons Artikel dazu nachlesen. Und ja, Manon, ich sage vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ja, danke für die Einladung. Und das war’s für diese Woche vom Spektrum-Podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Wie immer am Freitag gibt es dann eine neue Folge von uns. Bis dahin freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und teilt. Das hilft uns sehr. Auch dafür vielen Dank. Mein Name ist Max Zimmer, und ich sage Tschüss und macht’s gut. Spektrum der Wissenschaft – der Podcast von detektor.fm.