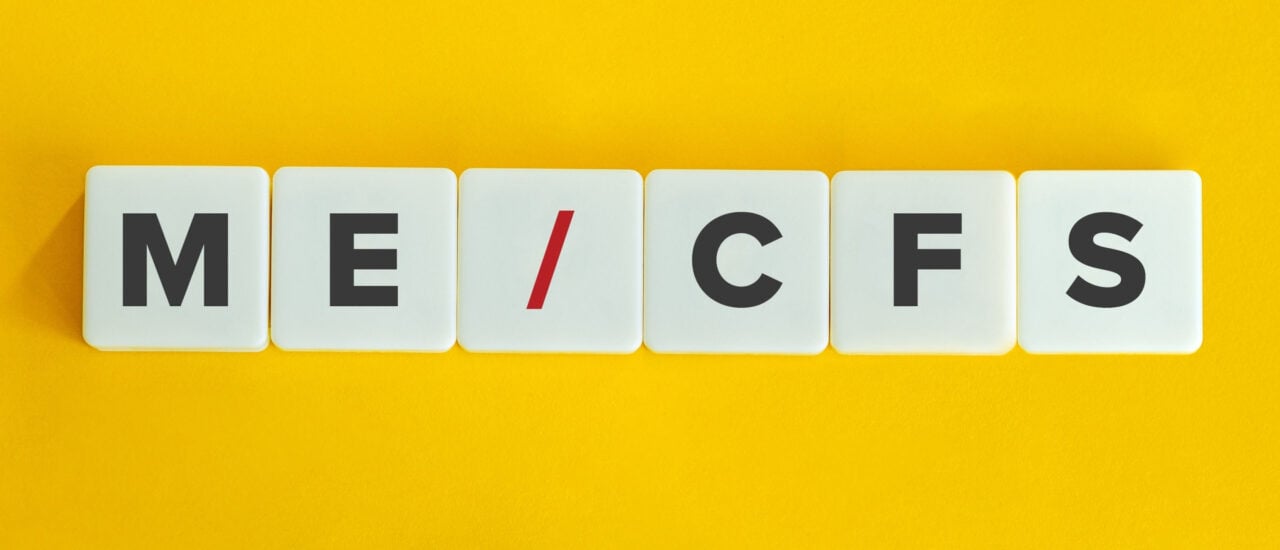Im April 2023 wurde die Corona-Pandemie offiziell für beendet erklärt. Für viele Menschen ist das Kapitel Covid allerdings immer noch nicht abgeschlossen. Und wird es vielleicht auch nie sein. Für viele bleiben langanhaltende Folgen. Bestimmt kennt ihr auch jemanden, die oder der an Long- bzw. Post- Covid leidet, also nach wie vor mit Symptomen zu kämpfen hat, die mal mit einer Corona-Ansteckung angefangen haben. Das Robert Koch Institut schätzt, dass zwischen 5 und 10 Prozent der Menschen in Deutschland betroffen waren oder es noch sind. Viele von ihnen leiden am chronischen Fatigue-Syndrom, kurz MECFS. Das ist eine schwere, komplexe Multisystemerkrankung. Die gab es auch schon vor Corona. Trotzdem gibt es immer noch keine zugelassenen Therapien. Wie der aktuelle Forschungsstand ist und warum es für Patientinnen und Patienten einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, darum geht’s hier heute. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Jessi Jus. Hi! Betroffene erzählen, sie fühlen sich wie lebendig begraben. Menschen mit dem chronischen Fatigue-Syndrom leiden an einer tiefen, krankhaften Erschöpfung. Für die meisten heißt das: im Bett bleiben. Die einfachsten Dinge fallen ihnen schwer. Schon geringe körperliche oder mentale Belastungen können zur Verschlechterung der Symptome führen. Viel Forschung zu MECFS gibt es noch nicht. Und das hat unter anderem auch zur Folge, dass Betroffene oft erst mal dafür kämpfen müssen, dass ihre Krankheit überhaupt anerkannt wird. Im Spektrum-Podcast berichtet Anna Lorenzen von Spektrum der Wissenschaft vom aktuellen Forschungsstand. Sie hat sich nämlich mit führenden ForscherInnen auf dem Gebiet MECFS getroffen und erzählt Detektor FM Moderator Marc Zimmer davon. Also, Frau Scheibenbogen ist Professorin für Immunologie an der Berliner Charité und sie gehört wirklich zu den wenigen Fachleuten in Deutschland, die sich auf MECFS spezialisiert haben. Ja, und sie forscht halt zu den Ursachen der Erkrankung und wie man das therapieren kann. Und das tut sie schon lange, also schon bevor das Coronavirus halt aufgetaucht ist und bevor ja die Erkrankung durch die Pandemie überhaupt bekannt wurde. Ja, sie forscht speziell zu den Veränderungen im Immunsystem. Sie hat auch eine Studienplattform ins Leben gerufen und hier finden klinische Studien zu Medikamenten statt. Und ja, sie hat tatsächlich auch 2022 das Bundesverdienstkreuz am Bande für ihren Einsatz bekommen für Betroffene mit MECFS. Und jetzt hat sowohl Nathalie Grams als auch viele andere Betroffene… Hast du ja gerade das Gefühl, dass diese Symptome dann doch häufig so ein bisschen als psychosomatisch irgendwie abgetan werden? Das ist ein häufiges Argument, was man hört. Was sagt denn dann Frau Scheibenbogen dazu, die sich schon lange damit befasst? Ja, also das mit der Psychosomatik hört man halt auch heute immer noch viel zu häufig und zuletzt tatsächlich auch von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, also der DGN. Die müssten es eigentlich besser wissen. Also die haben im Sommer ein Statement veröffentlicht, dass man bezüglich MECFS mehr auf psychosomatische Therapieansätze fokussieren sollte. Ja, genau. Und da hat es auch viel Kritik zugegeben und Frau Scheibenbogen bezeichnet das auch als Schlag ins Gesicht für die Betroffenen. Ja, um es mal klar zu sagen: Es geht nicht darum, dass man jetzt eine psychische Erkrankung als weniger schlimm darstellen will. Aber es geht darum, man muss natürlich ganz klar den Ursachen auf den Grund gehen. Und bei MECFS handelt es sich primär um eine Erkrankung, die durch eine Virusinfektion ausgelöst wird. Und es ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung und das ist auch alles mittlerweile durch Forschung gut belegt. Das Immunsystem der Patienten schießt quasi gegen den eigenen Körper. Ja, und die Auswirkung sieht man im Gehirn, in den Organen, in den Muskeln. Und ja, da gibt es viele konkrete Befunde mittlerweile. Und das sagt natürlich auch ganz klar Professor Scheibenbogen. Ja, und sie kritisiert diese Haltung auch sehr und sagt auch, dass das Statement der DGN nicht dem Stand der internationalen Forschung entspricht. Und es wurden ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder so psychosomatische Konzepte empfohlen, um den Patienten zu helfen. Das ist zum Beispiel Bewegungstherapie. Und das ist völlig kontraproduktiv, das hilft gar nicht und macht alles viel, viel schlimmer. Ja, und dieses Vorurteil, das gibt es halt schon wahnsinnig lange. Und Frau Scheibenbogen datiert das so auf die 50er, 60er Jahre zurück. Da gab es schon immer wieder Ausbrüche von MECFS. Aber das ist halt eine Krankheit, die vor allem Frauen trifft. Und man hat das schnell in die Schublade geschoben. Ja, psychisch bedingte Frauenkrankheit. Ja, und aus der Schublade kann man das schwer wieder rausholen. Und langsam kommt ein Umdenken in die Gesellschaft und in das medizinische System, auch dank der Pandemie. Und was wissen wir denn jetzt eigentlich Stand heute darüber, was da wirklich im Körper vor sich geht? Ja, also der Mechanismus hinter MECFS, also der Krankheitsmechanismus, ist noch nicht vollständig aufgeschlüsselt. Allerdings wurden in den letzten drei Jahrzehnten schon viele pathophysiologische Auffälligkeiten gefunden. Also mittlerweile weiß man, es ist eine neuroimmunologische Erkrankung. Das heißt, die betrifft das Immunsystem und das Nervensystem. Und was laut Professor Scheibenbogen ganz deutlich ist: Also Autoantikörper sind bei einem großen Teil der Patienten das Hauptproblem. Das sind Antikörper, die sich aufgrund einer Virusinfektion gegen den eigenen Körper richten können. Das kennt man beispielsweise ja auch von Multipler Sklerose. Und da greift das Immunsystem die Isolierschicht der eigenen Nervenzellen im Gehirn an. Genau, und bei MECFS ist es jetzt so, dass die Autoantikörper unter anderem an Stressrezeptoren binden. Und diese Stressrezeptoren sorgen unter anderem dafür, dass bei Belastung die Blutgefäße geweitet werden. Also das ist quasi wichtig für die autonome Steuerung im Körper, für das Herz-Kreislauf-System. Und ja, man weiß schon lange, dass das ein Problem ist bei MECFS. Und jetzt langsam kommt man auch wirklich dahinter, warum das so ist. Und eine mögliche Ursache könnte sein, dass diese Autoantikörper an den Beta-2-Rezeptor binden. Und Professor Scheibenbogen und ihr Team konnten halt zeigen, dass dieser Rezeptor da nicht mal richtig funktioniert und dass dadurch weniger Blut im Gehirn ankommt und in der Muskulatur. Und das kann tatsächlich schon zu einem großen Teil das Krankheitsbild erklären. Nehmen wir zum Beispiel die postexertionelle Malaise, also diese Verschlimmerung nach Belastung. Da schmerzen ja auch die ganzen Muskeln im Körper. Und das zeigt mittlerweile auch die Forschung, wie das passieren kann. Denn in den Muskelzellen, wie in allen anderen Zellen des Körpers auch, sind ja die Mitochondrien, die Kraftwerke. Und Mitochondrien erzeugen Energie mit Sauerstoff und Wasserstoff. Und genau, wenn da eine Minderdurchblutung stattfindet, weil die Gefäße nicht mehr richtig funktionieren, dann kommt es halt zum Sauerstoffmangel im Muskel. Und durch komplizierte Prozesse übersäuert der Muskel dann. Damit er nicht geschädigt wird, muss er dagegen ansteuern. Und dabei, um quasi Energie zu erzeugen, setzt er bestimmte Faktoren frei, um die Durchblutung zu verbessern. Und diese Stoffe können massive Schmerzen auslösen. Diese Muskelschäden kann man auch mithilfe von Biopsie mittlerweile nachweisen. Das heißt, man findet im Körper auch Entzündungen der Gefäße durch diese Autoimmunprozesse. Man findet Entzündungen im Gehirn und in der Hirnflüssigkeit. Und das alles, also diese Minderdurchblutung des Hirns und die Entzündungen, können halt die neurologischen Symptome erklären, wie beispielsweise Brain Fog. Das heißt, so psychisch bedingt ist er jetzt erstmal nichts. Und man kann das auch alles sehr schön, wer sich dafür interessiert, auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS durchlesen. Da ist alles sehr schön verständlich beschrieben. Okay, soviel jetzt mal zum Krankheitsbild. Wie sieht es denn aus mit den Heilungschancen und Behandlungsmöglichkeiten? Was kann man denn tun? Ja, also das kann man noch nicht genau sagen. Aktuell gibt es ja noch keine zugelassenen Kurativmedikamente. Das ist alles noch in der Erprobung. Aber da ist sehr vieles ja auf einem guten Weg. Also wenn man jetzt nichts tun würde, da gibt es halt eine winzige Spontanheilungsrate bei MECFS. Also nur ganz, ganz wenige Menschen kommen da aus eigener Kraft halt wieder raus. Aber da die Forschung jetzt endlich mehr Fahrt aufnimmt, steigen auch die Chancen auf effektive Behandlung. Und eine der vielversprechendsten Ansätze basiert laut Professor Scheibenbogen auf monoklonalen Antikörpern. Und die richten sich halt gegen diese Zellen, die die Autoantikörper produzieren. Das sind die B- und die Plasmazellen. Man kann auch noch einen Schritt weitergehen und gleich die Plasmazellen, also die reifen B-Zellen, aus dem Blut entfernen. Und in Norwegen wurde dazu eine erste Studie veröffentlicht. Und sie haben zehn MECFS-Patientinnen mit einer Pilotstudie mit dem bereits zugelassenen Antikörper gegen Plasmazellen behandelt. Und von diesen zehn Frauen sind sechs gut darauf angesprochen. Und fünf sind tatsächlich weitgehend genesen. Und darunter ist auch eine Frau, die seit 35 Jahren erkrankt war. Allerdings gibt es bei ME CFS viele Subgruppen, also Patienten, die sich hinsichtlich der Blutmarkern unterscheiden, so was Immunzellen angeht. Die haben unterschiedliche Muster im Blut. Das kann man auch testen. Dabei handelt es sich um verschiedene Varianten, Veränderungen in den B-Zellen und T-Zellen. Also das sind Immunzellen. Und in einer Studie von der Charité haben drei Viertel von MECFS-Patientinnen auf eine Blutwäsche angesprochen, also wo man diese Autoantikörper produzierenden Immunzellen entfernt hat. Und nur die, die ein bestimmtes Muster hatten im Blut, haben auf diese Behandlung angesprochen. Das heißt, es wird nicht eine Therapie geben für alle. Man muss ganz genau gucken, wie unterscheiden sich die Patienten und was hilft denen dann im Speziellen. Und woran wird da so aktuell gerade geforscht, um eben Betroffenen künftig auch besser helfen zu können? Ja, also an der Charité wurde 2022 eine Studienplattform aufgebaut. Da werden halt klinische Studien durchgeführt, die auch vom Bund gefördert werden. Und hierbei werden aktuell verschiedene Optionen ausprobiert. Also Immunabsorption, also Blutwäsche, um Antikörper und Autoantikörper produzierende Immunzellen aus dem Blut zu entfernen. Oder auch hochdosiertes Prednisolon, das ist, um Entzündungen zu bremsen. Außerdem wird ein Medikament zur besseren Durchblutung getestet, sowie die hyperbare Sauerstofftherapie. Und hierbei wird mit hohem Druck Sauerstoff verabreicht, über Wochen und immer wieder. Und das steigert wohl bei vielen die kognitive Leistungsfähigkeit wieder und lindert die Fatigue. Genau, und aktuell wurde eine Förderung beantragt, um mehrere monoklonale Antikörper zu testen. Und ja, wenn diese Förderung bewilligt wird, dann war Frau Scheibenbogen auf voller Hoffnung, dass das schnell umgesetzt wird und dann auch in die Zulassungsstudien jetzt bald geht. Anna Lorenzen hat sich mit einer führenden Forscherin auf dem Gebiet MECFS getroffen: Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin. Und berichtet im Spektrum-Podcast über die Heilungschancen für Betroffene. Wenn ihr die Folge noch mal in voller Länge nachhören wollt, ist das natürlich kein Problem. Ich verlinke sie euch einfach in den Shownotes. Diese Folge, zurück zum Thema, wurde von Benjamin Zerdani produziert. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!