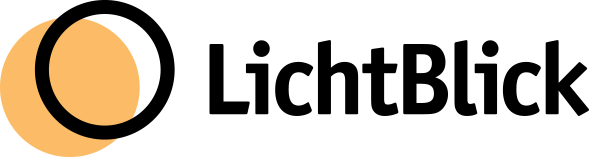Dass der Klimawandel umfassende Auswirkungen auf die Landschaft und Natur hat, sieht man in vielen Ecken der Welt, vor allem aber an den Gletschern. Denn die schmelzen, ganze Ökosysteme verändern sich. Außerdem kommt es zu Naturkatastrophen, ausgelöst durch Lawinen und Felsstürze. Welche Folgen des Klimawandels sind jetzt schon in den Bergen erkennbar? Und wie wird sich die Landschaft entwickeln? Das beantworten wir heute hier im Klima-Podcast von detektor.fm. Ich bin Ina Lebedjew. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kleine Felsstürze und Bewegungen am Berg sind normal, sagen Fachleute. Mittlerweile kommt es in Hochgebirgslagen aber immer häufiger zu großen Felsstürzen. Zuletzt sind im Mai dieses Jahres im Schweizer Lötschental, das liegt im Südwesten der Schweiz in den Berner Alpen, neun Millionen Kubikmeter Eis, Schlamm und Gestein abgestürzt. Medienberichten zufolge haben die Geröllmassen damals erst ein halbes Dorf unter sich begraben. Dann stauten sie einen Fluss auf, der wiederum die verbliebenen Häuser im Dorf geflutet hat. Ein beispielloses Ereignis, schätzen WissenschaftlerInnen ein. Das Worst-Case-Szenario sei eingetreten, wobei die ExpertInnen nicht mit dieser Menge an Schutt und Geröll gerechnet hatten, heißt es. Einer der Hauptgründe für solche Felsstürze ist auftauender Permafrost. Was genau das bedeutet und wie sich die Bergwelt in den kommenden Jahrzehnten verändern wird, das weiß meine Kollegin Alina Metz. Hallo Alina! Hallo, Ina! Wir wollen uns ja heute auf die Alpen und ihren Wandel konzentrieren. Wie ist denn da der aktuelle Zustand? Ganz einfach gesagt: sehr schlecht. Also die Alpen, aber auch andere Hochgebirge weltweit, leiden ExpertInnen zufolge unfassbar unter dem Klimawandel. Wir sehen ein Extremjahr nach dem nächsten, das kann man wirklich so sagen. Obwohl wir 2025 nicht ganz so starken Verlust hatten wie 2022 und 2023, die bisher schlimmsten Jahre in den Alpen überhaupt, sind wir auf einem sehr hohen Niveau, was die Schmelze betrifft. Das sagt Matthias Huss. Der Glaziologe ist Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes GLAMOS. Seine Forschung konzentriert sich auf das Verhalten von Gletschern gegenüber den Klimaveränderungen. Dafür ist er regelmäßig in den Gletschern unterwegs und betreibt viel Monitoring zur Schmelze oder im Winter eben zur Schneeanlagerung. Und dem Glaziologen zufolge ist der Zustand der Gletscher ganz klar auf die steigenden Temperaturen zurückzuführen. Das liegt daran, dass die Gletscher nicht schnell genug reagieren und sich somit nicht in höhere Lagen zurückziehen können. Wusstest du denn, dass sich Gletscher in höhere Lagen zurückziehen können? Also mir ist es nicht bekannt gewesen, ehrlich gesagt. Ich war ganz schön überrascht, als ich das gelesen habe im Skript. Mir ging es ähnlich. Also hat mich auch definitiv überrascht, einfach weil ich dachte, dass sie einfach nur da sind und dann zur Not halt schmelzen, aber nicht, dass sie quasi ebenfalls auch nach oben ziehen können. Ja, fantastisch! Krass! Aber dass sie das dann eben nicht so schnell können, das hat dann direkte Folgen auf die Landschaft im Hochgebirge und natürlich auch für die Menschen, die in den Tälern leben. Kannst du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was da passiert? Na klar, gerne! Also allgemein kann man sagen, dass die Gletscherfläche abnimmt und auch die Bergflanken von immer weniger Schnee bedeckt sind. Das wirkt sich dann natürlich auf den Tourismus aus, vor allem aber auf die Bergwelt und die Talregion. Für die Natur konkret bedeutet das, dass es zu mehr Gefahren kommt. So sind Steinschläge, Bergstürze, Lawinen und Gletscherfluten deutlich wahrscheinlicher. Ja, und unter anderem auch im Sommer. Also womit man bisher nicht gerechnet hat, auch das passiert ja inzwischen schon, dass eben Gletscherteile abstürzen zu Zeiten, an denen man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Genau. Jetzt haben wir uns hier bei Mission Energiewende ja 2018 schon mal mit dem Thema beschäftigt. Das ist eine Weile her. Da ging es unter anderem um die Folgen für die Pflanzenwelt. Du hast dir die Folge ja angehört. Was hat es denn damit auf sich? Ja, da war ich tatsächlich auch wieder ganz überrascht und fasziniert davon, wie die Natur auf solche Klimaveränderungen reagiert. Denn Pflanzen wie die Alpenrose zum Beispiel reagieren sehr sensibel auf steigende Temperaturen und ziehen dann wortwörtlich um. Das heißt, ähnlich wie die Gletscher ziehen auch Pflanzen einfach in höhere Gegenden um. Doch leider ist das Problem damit nicht final gelöst, hat die damalige detektor.fm-Redakteurin Lara Lena Götte in der Folge von vor sieben Jahren erklärt. Denn neben Temperatur müssen natürlich auch noch viele andere Faktoren stimmen, wie zum Beispiel die Bodenbeschaffenheit. Und wenn der jetzt zum Beispiel besonders steinig ist, dann können da bestimmte Pflanzen vielleicht nicht wurzeln und verlieren dementsprechend ihren Lebensraum. Dieser Umzug von Pflanzen wirkt sich dann wiederum auch auf die Tierwelt aus, denn den Insekten fehlen natürlich Nahrungsquellen. Doch nicht nur die Ökosysteme verändern sich mit dem Wandel in den Bergen, sondern auch der Meeresspiegel. Inwiefern? Wenn Süßwasserreserven schmelzen, die in den Bergen gespeichert sind, dann gelangt das Wasser unmittelbar in den Ozean. Dadurch steigt dann logischerweise der Meeresspiegel. Auch wenn man dazu sagen muss, dass die Alpengletscher nur einen kleinen Teil dazu beitragen, ganz im Gegensatz zu den Eismassen in den polaren Gebieten oder in Grönland. Eine direkte Folge ist es dennoch. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Ihr wollt 100 % Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Nun hatte ich am Anfang ja schon mal über die zunehmenden Felsstürze gesprochen, zuletzt der große im Schweizer Lötschental. Wie genau kommt das jetzt dazu? Also am Ende ist das definitiv ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, hat mir der Schweizer Glaziologe Matthias Huss erzählt. Eine wichtige Rolle dabei spielt der Permafrost, der auftaut, wenn die Gletscher schmelzen. Und Permafrost, da bin ich ehrlich, das ist so ein Wort gewesen, über das ich immer wieder gestolpert bin. Übrigens auch in einer zweiten Mission Energiewende-Folge zum Thema Berge und Klima aus dem Jahr 2018. Und da haben die KollegInnen erklärt, dass Permafrost wie eine Art Leim ist, der die Berge zusammenhält. Matthias Huss hat mir das dann noch mal genauer beschrieben. Permafrost ist gefrorener Boden, also Untergrund, der ganzjährig eine Temperatur von weniger als 0 Grad aufweist. Und bei uns heißt das, dass wenn Wasser in diesen Untergrund eindringt, durch Felsritzen oder durch die Poren im Geröll, im Sand, das Wasser gefriert. Und dieses Wasser hält dann diese Felsfruchtstücke, diesen Sand, dieses Geröll zusammen und stabilisiert damit die Berge. Und wenn die Temperaturen nun steigen, dringt die Wärme tiefer in den Untergrund ein und kann dem Permafrost teilweise auftauen. Und dazu ermöglicht es auch dem Wasser, weiter in den Untergrund einzudringen. Und Wasser in einer steilen Gefälsmasse übt immer große Drücke aus. Und das steigert eben auch die Gefahr, dass es Felsstürze, Steinschlag oder auch größere Abbrüche gibt. Matthias Huss betont aber, dass nicht alle Felsstürze mit dem Permafrost zusammenhängen. Denn die Gletscher selbst haben auch eine Stützfunktion für die Berge. Ihre Masse stützt quasi die Hänge ab, indem das Gletschereis oder der Schnee die Felsflanken bedecken und damit das Geröll stabilisieren, das darunter liegt. Wenn jetzt die Gletscher wegschmelzen, werden diese Felsflanken eben Schnee und Eis frei und damit destabilisiert. Oh Mann, das klingt ganz schön dramatisch. Wie schätzen das die Fachleute ein? Ist der Wandel in den Bergen noch irgendwie aufzuhalten? Der Glaziologe ist da recht bestimmt und sagt: Nein. Die Szenarien sind ziemlich klar, dass wir in den Alpen bis zum Ende dieses Jahrhunderts praktisch alle Gletscher verlieren werden. Wir haben schon in den letzten zehn Jahren in der Schweiz einen Viertel der Gletschermasse eingebüßt. Also eine unglaublich schnelle Veränderung. Und wenn die Erwärmung endlich weitergeht, wie sie das in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, dann verlieren wir wirklich alle Gletscher in den nächsten Jahrzehnten. Ihm zufolge gibt es eigentlich nur eine Hoffnung: das Klima zu stabilisieren und wirklich mit den CO2-Emissionen in den nächsten Jahrzehnten auf Null zu gehen. Das würde man einen kleinen Teil der Alpengletscher retten. Klein, aber auch nur im Sinne von etwa einem Viertel oder einem Drittel der jetzt noch vorhandenen Masse. Wahnsinn! Das heißt, es erwarten uns auch in Zukunft mehr Felsstürze, Lawinen, Fluten und Landschaftsveränderungen. Definitiv! Wir sind derzeit in einem Übergangsbereich, erklären die Fachleute, in dem die Landschaft versucht, sich noch anzupassen. Man kann also sagen, dass sich das Gebirge quasi neu anordnet. Dennoch versucht der Gletscherforscher, dem Wandel etwas Positives abzugewinnen. Wir sind auf dem Weg von vergletscherten Alpen, von einem vergletscherten Gebirge zu einem eisfreien Gebirge. Und ich gehe davon aus, dass es im Endstadium dann auch wieder eine Stabilisierung der Berge gibt. Also Alpen ohne Eis müssen nicht an sich problematisch und instabil sein. Alpen ohne Eis können auch schön sein. Es gibt neue Bergseen. Die Vegetation nimmt sich ihren Platz zurück und wandert in die Höhe. Das heißt, es ist eine Veränderung, die wir im Alpenbereich sehen, die aber nicht nur negative Folgen hat. Ich habe neulich einen Podcast gehört zum Thema, und da war Georg Bayerle zu Gast. Der ist langjähriger Bergexperte beim Bayerischen Rundfunk. Und auf die Frage, ob wir denn in den nächsten fünf Jahren noch in die Alpen können, meinte er, es sei sogar ganz wichtig, dass Menschen weiter in die Alpen gehen, weil wir eben nur schützen können, was wir kennen. Aber in Zukunft müssten die Menschen, die das Wandern in den Bergen und das Bergsteigen lieben, eben mit einem neuen Bewusstsein rangehen. Menschen, die die Berge lieben, müssten sich also selbst mit dem Risiko konfrontieren. Und Bayerle sagt auch noch, gerade in den Bergen, in den Alpen, sieht man, was los ist. Und gleichzeitig könnten die Menschen dort in den Tälern zum Beispiel Vorbilder für uns alle sein, denn Ressourcensparen, Upcycling seien schon seit Jahrhunderten ganz normal in den Dörfern der Alpen. Ja, genau, das sieht Matthias Huss ähnlich. Also die Gletscher, sagt er, sind wichtig für den Tourismus und dementsprechend auch wichtig in der Klimakommunikation, weil die Gletscher für uns normalerweise, sagen wir jetzt mal, eben einfach verständlich sind. Wenn das Klima sich erwärmt, dann gehen sie zurück. Es gibt ein klares Bild. Und deshalb haben die Gletscher eine Wichtigkeit für diese Botschaft des Klimawandels an die Öffentlichkeit zu bringen. Wie verändern sich die Berge und Gletscher im Klimawandel? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit dem Schweizer Glaziologen Matthias Huss gesprochen. Er ist Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes GLAMOS. Danke für deine Recherche und für das Gespräch, Alina. Gerne! Das war der Klima-Podcast von detektor.fm für diese Woche. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert Mission Energiewende gerne auf der Plattform eurer Wahl und empfiehlt uns weiter. Das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank! Die Produktion für diese Folge hatte Wiebke Stark. Vielen Dank dafür auch natürlich. Und die Redaktion lag bei mir. Ich bin Ina Lebedjew. Ich sage Ciao und bis nächste Woche hoffentlich. Macht’s gut. Tschüss! Mission Energiewende. Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter, mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 % Ökostrom.
 Foto: Andreas Linsbauer, Universität Zürich
Foto: Andreas Linsbauer, Universität Zürich