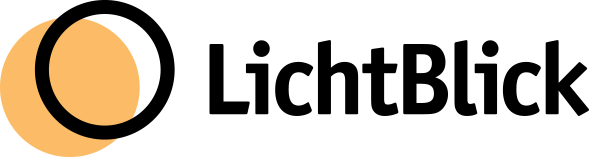Grüner Wasserstoff wird und wurde als das Gold der Energiewende bezeichnet. Noch vor ein paar Jahren gab es einen regelrechten Hype darum. Mittlerweile herrscht eher Ernüchterung. Deutschland erreicht seine Ziele nicht, unter anderem weil klar ist, wir können den Wasserstoff, den wir brauchen, nicht alleine produzieren. Dafür fehlen große Mengen grünen Stroms, denn Wasserstoff ist extrem energieintensiv in der Herstellung. Deshalb lagern deutsche Unternehmen die Produktion aus, in den globalen Süden, zum Beispiel nach Namibia. Aber genau dort hat Deutschland eine brutale koloniale Vergangenheit. Ihr hört den Klima-Podcast von detektor.fm. Ich bin Ina Lebedjew. Hi, Mission Energiewende! Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E- Mobilität und 100 Prozent Ökostrom. Damit die Energiewende gelingt und weltweit klimaneutraler gewirtschaftet wird, brauchen wir internationale Kooperationen. Aber was passiert, wenn diese Partnerschaften alte Machtungleichheiten fortschreiben? Wenn der globale Norden, also auch Deutschland, saubere Energie will, aber dafür auf Ressourcen und Land im globalen Süden zugreift? Darüber sprechen wir heute. Meine Kollegin Ronja Morgenthaler ist jetzt mit mir im Studio. Hallo Ronja! Hi Ina! Unser Podcast heißt ja Mission Energiewende. Hier geht es darum, zusammen Lösungen für die Klimakrise zu besprechen. Genau, so eine Lösung ist doch eigentlich Wasserstoff, oder? Ja, also rein in der Theorie ist Wasserstoff wirklich ein super Energieträger, weil sein Hauptanteil eben Wasser ist. Und davon gibt es auf der Erde erst mal reichlich. Durch Elektrolyse wird Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Aber jetzt kommt die Krux: Dafür braucht man eben extrem viel Strom. Und wenn Wasserstoff grün sein soll, dann muss dieser Strom natürlich aus erneuerbaren Energien kommen. Du meinst, wenn wir fossile Energien nutzen, um Wasserstoff herzustellen, dann ist damit nichts gewonnen? Genau, dann ist er, um bei dieser Farbpalette zu bleiben, grau. Und grauer Wasserstoff wird mit Hilfe von Erdgas hergestellt. Und bei der Produktion einer Tonne grauem Wasserstoff entstehen rund zehn Tonnen CO2. Und grauer Wasserstoff ist offenbar immer noch die Norm. Ich habe gelesen, dass nur ein Anteil von fünf Prozent des Wasserstoffs, der in Deutschland verwendet wird, wirklich grün ist. Kannst du bitte für den Hinterkopf noch mal erklären, warum ist Wasserstoff jetzt eigentlich so zentral für die Energiewende? Du hast es eingangs ja schon gesagt: Wasserstoff gilt als das Gold der Energiewende. Denn da, wo die Elektrifizierung schwierig ist, also zum Beispiel in der Stahl- und Chemieindustrie oder bei Flugzeugen oder in der Schifffahrt, ist Wasserstoff wirklich wichtig. Aber eben nicht für E-Fuels, zum Beispiel wie sich das die Autoindustrie vorstellt. Das wäre eine riesige Verschwendung. Und weil er eben so energieintensiv ist, sollte er nur da eingesetzt werden, wo man mit Strom alleine nicht weiterkommt. Okay, da steht Deutschland ja jetzt trotzdem vor einem Problem, oder? Also bisher sind so etwas mehr als 50 Prozent des Stroms erneuerbar. Da jetzt noch den grünen Strom für die Wasserstoffproduktion draufzuschlagen, scheint da eher unrealistisch. Richtig? Zwar plant Deutschland in der nationalen Wasserstoffstrategie bis 2030 Elektrolyseanlagen mit einer Leistung von 10 Gigawatt. Aber selbst das reicht nicht. Man geht davon aus, dass Deutschland nur etwa ein Drittel des Wasserstoffs selbst herstellen kann. Der Rest soll importiert werden, vor allem aus Regionen mit viel Sonne und Wind. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Ihr wollt 100 Prozent Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Ja, und da sind wir dann beim Thema von heute, oder? Genau, Energie aus anderen Teilen der Welt zu importieren ist natürlich nicht unproblematisch. Wenn riesige Solar- oder Windparks gebaut werden, um den Strom für Wasserstoff zu gewinnen, gibt es Konflikte um Land, Wasser und Lebensraum. Da werden teilweise ganze Gemeinschaften verdrängt, oft indigene Gruppen. Das technische Wissen, das Kapital und die Entscheidungsmacht liegen aber im globalen Norden. Ja, das klingt nicht nach Partnerschaften auf Augenhöhe und es erscheint auch doppelt ungerecht. Der globale Süden leidet sowieso schon stärker unter den Folgen des Klimawandels. Und jetzt liefert er dann auch noch die Flächen und Ressourcen, damit der Norden seine Klimaziele erreicht. Genau, also das Problem ist also nicht der grüne Wasserstoff als solcher, sondern die Bedingungen unter denen er produziert wird. Wer trägt die Kosten? Und das zeigt sich ganz konkret bei einem Projekt in Namibia, das ich mir angeschaut habe. Du hattest die Chance, mit jemandem über das Thema zu sprechen, der von dem Projekt direkt betroffen ist. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Ja, und zwar habe ich Paul Thomas getroffen. Er ist Mitglied der Nama Traditional Leaders Association. Das ist eine Organisation, die die Interessen der indigenen Nama in Namibia vertritt. Und Paul Thomas war auf Speakerstour in Deutschland, um über Wasserstoffprojekte in Namibia zu sprechen. Eine wirklich besondere Gelegenheit, einen Vertreter dieses Volkes zu treffen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr spannend. Und worum geht es da jetzt ganz genau? Es geht um das sogenannte HIFEN-Projekt im Süden Namibias. Das ist ein gigantisches Vorhaben, gebaut von der britischen Nicholas Holding Limited und dem deutschen Unternehmen Enertrag. RWE war auch kurz beteiligt, ist aber vor kurzem ausgestiegen. Namibia soll damit zu einem wichtigen Produzenten und Exporteur von grünem Wasserstoff werden. Und zwar vor allem für Märkte in Europa. Die namibische Regierung sieht in dem Projekt eine Chance für wirtschaftliche Entwicklung und neue Arbeitsplätze. Aber es gibt eben auch erhebliche Kritik. Okay, und worin besteht diese Kritik? Die KritikerInnen bemängeln, dass die Stimme der lokalen Bevölkerung nicht gehört wird, dass die Energie ausschließlich für den Export in den globalen Norden vorgesehen ist und dass die geplanten Anlagen empfindliche Ökosysteme bedrohen. Der größte und wichtigste Kritikpunkt aber hängt mit der deutschen Kolonialgeschichte zusammen. Die Anlagen sollen auf dem Gebiet der Nama entstehen. Das heißt in einer Region, in der Deutschland vor mehr als 100 Jahren den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verübt hat. Hören wir Paul Thomas dazu: Zwischen 1904 und 1908 starben bis zu 50 Prozent der Menschen des gesamten Nama-Volkes. Die Nama haben sich von dieser Verwüstung, von diesem Trauma nie erholt. Sie verloren Menschenleben, Land, Kultur, Erbe und ihre Lebensgrundlagen. Heute sind sie eine Minderheit in Namibia, gemeinsam mit den Herero. Die Nama sind heute eine der ethnischen Gruppen, die die Minderheit in Namibia sind. In den letzten Jahren wurden ganze Gemeinschaften ausgelöscht, Männer, Frauen und Kinder in die Wüste getrieben oder in Lager deportiert. Eines dieser Lager lag auf Shark Island bei Lüderitz, und genau dort soll jetzt eben Infrastruktur für dieses riesige Wasserstoffprojekt entstehen. Und das ist der Ort, den HistorikerInnen heute als eines der ersten Konzentrationslager der Welt bezeichnen. Es war zu dieser Zeit, dass die Deutschen Methoden ausprobierten, die sie später im Holocaust an den Juden einwanderten. Das war also tatsächlich der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, ein Ort des Hungers und der Volltang. Ach krass, ehrlicherweise war mir das nicht klar oder zumindest nicht mehr präsent. Korrigiere mich gerne, aber ich würde annehmen, dass über diesen ersten deutschen Völkermord hierzulande kaum gesprochen wird. Nein, das ist überhaupt nicht im kollektiven Bewusstsein, welche Verbrechen Deutschland als Kolonialmacht in Namibia verübt hat. Und bis heute ist kein Geld zur Wiedergutmachung geflossen. Dabei hat der Völkermord nach wie vor Auswirkungen auf die indigene Gruppe der Nama. Der Völkermord wirkt bis heute nach. Wir sind noch immer landlos, entrechtet, ohne politische Macht und können das bestehende Unrecht nicht verändern. Und das Problem ist aber nicht nur die Geschichte, sondern dass auch jetzt bei diesem riesigen Energieprojekt die indigene Bevölkerung überhaupt nicht einbezogen ist. Paul Thomas spricht von einer fortgesetzten Geschichte der Ausbeutung. Durch diesen historischen Kontext baut das HIFEN-Projekt auf Ungerechtigkeiten auf und führt sie fort. Es findet auf dem Land statt, das den Nama gewaltsam genommen wurde, und es verstärkt Marginalisierung und Armut. Das Projekt setzt eine Geschichte der Ausbeutung fort, die die Nama systematisch ausgeschlossen und verarmt hat. Wenn diese Bedenken ignoriert werden, beteiligt man sich an einer weiteren Form der Ausbeutung und Entfremdung und verschärft das intergenerationale Trauma. Ich habe Paul Thomas ja im Rahmen eines Vortrags während seiner Deutschland-Tour getroffen und am Rande der Veranstaltung konnte ich auch kurz mit Nafimane Manohar Mukhochi sprechen. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Economic and Social Justice Trust, eine Organisation, die sich seit mehr als zehn Jahren für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit in Namibia einsetzt. Und was kritisiert sie an den Wasserstoffprojekten? Sie sagt ganz klar: Das Problem ist nicht der grüne Wasserstoff an sich, sondern die Art, wie die Projekte umgesetzt werden. Ich stimme zu, dass grüner Wasserstoff selbst nicht das Problem ist, sondern wie das Projekt umgesetzt wird. Es gibt keinen rechtlichen Rahmen, der das klar regelt. Eigentlich müsste alles auf freier, vorheriger und informierter Zustimmung beruhen, aber meistens ist es nur freie, vorherige Zustimmung ohne Information. Die Kritik richtet sich also weniger gegen die Technologie, sondern vor allem gegen fehlende Mitsprache und mangelnde Transparenz. Ja, richtig. Namibia ist ein Land, das schon heute unter den Folgen der Klimakrise leidet. Gleichzeitig leben viele Menschen dort in Energiearmut. Das ist die paradoxe Situation: Auf namibischem Boden soll Energie für den Export nach Europa produziert werden, während viele Menschen vor Ort gar keinen Zugang zu sauberer Energie haben. Wir erleben immer mehr Dürren und manchmal Überschwemmungen, die die Lebensgrundlagen der Menschen zerstören. Kürzlich haben Überschwemmungen ganze Häuser mitgerissen und die Wohnbedingungen sind ohnehin schlecht. Es wird sehr schwierig, sich an den Klimawandel anzupassen oder ihn abzumildern. Wenn die namibische Regierung so etwas in Deutschland tun würde, würde das niemand akzeptieren. Es sollte ein beidseitiger Prozess sein, mit gegenseitigem Respekt. Dieses Projekt wäre kein Problem, wenn sie vorher Konsultationen durchgeführt hätten. So, wie sie behandelt werden wollen, sollten sie uns auch behandeln. Kannst du jetzt zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen, welche Erkenntnisse du aus der Recherche für dich mitnimmst? Also Namibia braucht saubere Energie, genauso dringend wie Deutschland. Aber wenn deutsche Unternehmen Energie für Deutschland produzieren, auf Land, auf dem ein Völkermord begangen wurde, ohne dass die Nachfahren der Opfer wirklich mitbestimmen können, dann ist das ein riesiges Problem. Es braucht also beides: Die Energiewende und echte Partnerschaften auf Augenhöhe. Gibt es denn irgendwas? Du hast gesagt, es war auch so eine ganz besondere Gelegenheit, eine Chance, mit jemandem zu sprechen von dem Volk der Nama. Ist dir da im Rahmen der Veranstaltung irgendwas im Gedächtnis geblieben, das du wichtig findest, noch mal zu erwähnen? Tatsächlich war das für mich ein sehr berührender Abend. Also, dass sowohl Paul als auch Nafimane nach Deutschland kommen, um hier darüber aufzuklären, was deutsche Unternehmen auf dem Gebiet der Nama planen und umsetzen, vor dem Hintergrund dieses Völkermords, über den in Deutschland einfach niemand spricht und der im Alltag absolut keine Rolle spielt. Das hat einen ziemlich bitteren Beigeschmack, um das Wenigste zu sagen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr zum Nachdenken gebracht. Grüner Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger der Energiewende, und gleichzeitig zeigt diese Folge, wie eng Klimapolitik, Wirtschaft und Geschichte miteinander verwoben sind. Meine Kollegin Ronja Morgenthaler ist der Frage nachgegangen, was passiert, wenn der globale Norden, also auch Deutschland, saubere Energie will und dafür auf Ressourcen im globalen Süden zugreift. Dafür hat sie mit Paul Thomas gesprochen. Er ist Mitglied der Nama Traditional Leaders Association und mit Nafimane Manohar Mukhochi. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Economic and Social Justice Trust. Danke dir für die Recherche und für das Gespräch. Danke dir, Ina. Das war der Klimapodcast von detektor.fm für diese Woche. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert Mission Energiewende gerne auf der Plattform eurer Wahl, empfiehlt uns weiter und teilt unsere Folgen gerne mit Freundinnen, Kolleginnen und allen, die das Thema Klima am Herzen liegen. Das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank! Die Produktion für diese Folge hatte Tim Schmutzler. Vielen Dank dafür, und die Redaktion lag bei mir. Ich bin Ina Lebedjew und ich sage ciao, bis nächste Woche. Macht’s gut! Tschüss! Mission Energiewende! Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 Prozent Ökostrom.
 Foto: privat
Foto: privat Foto: privat
Foto: privat