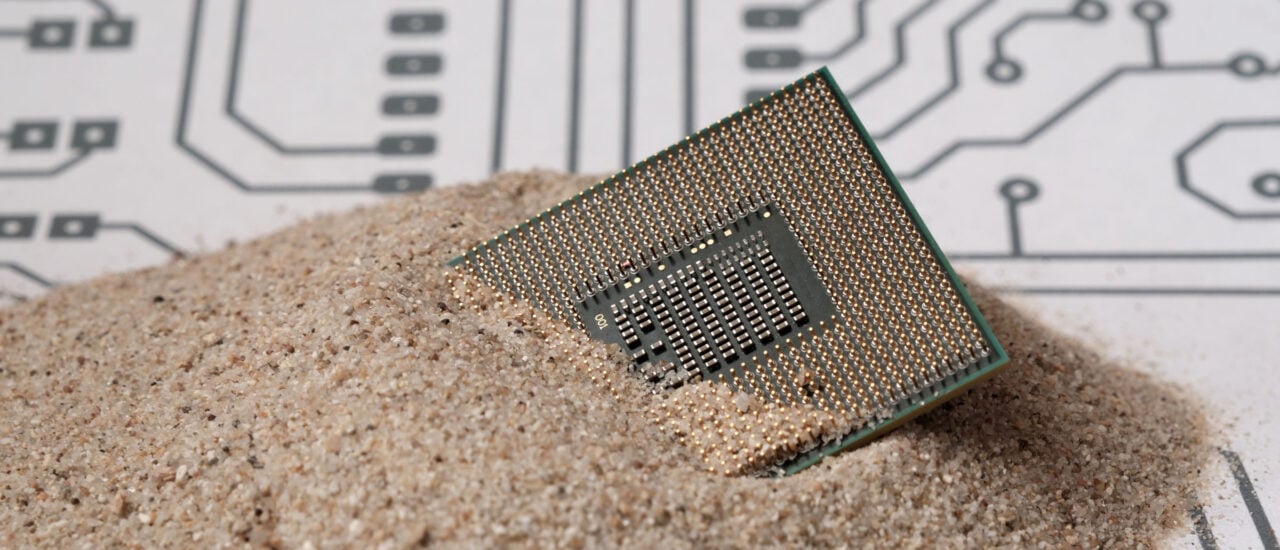Vom Steinzeit-Tool bis hin zum Silizium-Chip: Die Materialien, die wir nutzen, bestimmen ja irgendwie auch unser Leben. Wir schauen uns heute an, wie Werkstoffe unsere Kultur, unsere Identität und auch unsere Zukunft prägen und warum die Dinge, die wir erschaffen, längst so eine Art Eigenleben führen, könnte man sagen. Darum geht’s diesmal bei uns hier im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Max Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm. Ja, wir sprechen heute über die Dinge, die uns alle ganz selbstverständlich umgeben. Sie stecken in unseren Laptops und Handys, in allem, was wir tagtäglich benutzen, in unseren Karten, in unseren Möbeln, Autos, Fahrrädern und so weiter. Es geht nämlich um bestimmte Materialien oder Werkstoffe. Also alles, was wir anfassen, benutzen oder tragen, besteht quasi aus denen. Aber wir fragen uns selten, was diese Stoffe eigentlich so über uns aussagen. Denn Materialien, das sind eben nicht nur Mittel zum Zweck, sondern die erzählen ja häufig auch eine Geschichte, oft über uns, die Menschen, die sie eben benutzen. Und das ist heutzutage ganz besonders interessant, denn wir stehen an so einer Art Wendepunkt im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, von 3D-Druck und auch von selbstheilenden Werkstoffen. Da fragt man sich ja, was passiert denn eigentlich, wenn Materialien anfangen, sich selbst zum Beispiel zu reparieren oder von selbst zu wachsen oder sogar von selbst zu denken? Was bedeutet das für uns Menschen? Alles Fragen, die sich Spektrum der Wissenschaft gerade in einer Themenwoche gestellt hat. Da geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Material und auch um neue Formen von Material. Und über all das will ich sprechen mit Lars Fischer. Der ist Chemiker und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft. Hallo Lars! Moin, Max! Ja, Lars, du hast die Themenwoche bei Spektrum gerade verantwortet und da sind viele interessante Sachen dabei. Lass uns doch vielleicht mal so einsteigen: Dieser Begriff Material, das ist ja ein sehr, sehr weiter. Lass uns mal vielleicht kurz definieren, worüber sprechen wir denn hier? Das ist tatsächlich ein sehr weiter Begriff. Im weitesten Sinne meinen wir damit erstmal den Stoff, aus dem ein Ding ist. Und wenn wir das auf uns beziehen, dann ist das ein Stoff, aus dem ein Ding ist, das wir benutzen, aus dem wir etwas herstellen können, zu dem wir in irgendeiner Weise eine materielle Beziehung haben – eben Material. Und wir sind ja heute in unserer Gesellschaft in der Situation, dass wir quasi alles benutzen können, dass wir quasi das gesamte chemische Periodensystem benutzen können, bis auf ein paar Elemente, die vielleicht zu instabil sind oder zu teuer. Aber wir benutzen eigentlich alles, was greifbar ist. Wir benutzen also Rohstoffe, wir bauen künstliche Materialien dann eben aus diesen Rohstoffen. Das heißt, im Grunde ist Material ja alles, wozu wir eine sozusagen interaktive Beziehung haben. Und es ist ja so, dass wir eigentlich seit Menschengedenken die Dinge, die so um uns rum sind, eben zum Material machen, also quasi materialisieren für uns und benutzen. Von der Steinzeit bis heute ist das so. Inwiefern kann man denn sagen, hat diese Entwicklung auch die menschliche Zivilisation geprägt? Das war von Anfang an mit ziemlicher Sicherheit ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil wir ja heute in unserer Welt sind, wir sind von diesen Materialien komplett umgeben. Nicht nur in Form unserer Häuser oder Werkzeuge, sondern auch Kleidung, Brille, was auch immer. Also alles um uns herum. Und das ist natürlich etwas, wenn wir so intim mit diesen Materialien werden, dann werden die natürlich auch ein Teil von unserer Kultur. Natürlich machen die Materialien die Möglichkeiten, was wir Menschen tun können, wie weit wir gehen können, was wir erschaffen können. Und das, was wir erschaffen können, was wir im Alltag machen, das definiert auch unsere Kultur. Die folgt dem dann letztendlich. Und dadurch, dass diese Werkstoffe und Materialien dann so eng mit unserer Kultur auch verknüpft sind, werden sie sehr, sehr essentiell für unser Selbstbild und auch das Bild, das eine Zivilisation von sich hat. Wo man jetzt heutzutage sich quasi umguckt: Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns letztendlich über unseren materiellen Besitz definieren, über unsere materiellen Möglichkeiten, Status zum Beispiel. Die einen fahren Auto, die anderen fahren Fahrrad, die anderen haben Privatjet. Auch das ist natürlich materielle Kultur, verbunden mit Selbstbild, mit der Art und Weise, wie wir uns sehen. Und wir sehen uns selbst, unsere Kultur, unsere Welt durch diese Materialien. Und das tun wir als Menschen wahrscheinlich schon immer. Und wir schreiben ja auch bestimmten Materialien, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Gold, Diamanten oder auch bestimmten Metallen, jetzt oder Stahl von mir aus, da hat man auch direkt so ein Bild im Kopf. Also wir schreiben denen irgendwie so symbolische Werte zu. Das sagt ja auch irgendwie was über uns aus. Ja, das ist eben auch eine Funktion dieser sehr engen Beziehung mit Materialien, weil wir natürlich von den Materialien umgeben sind, kennen wir sie natürlich auch ganz genau. Wir wissen, welche Eigenschaften sie haben. Und wir Menschen haben nicht nur bei Materialien, sondern auch bei ganz vielen anderen Dingen, bei Naturphänomenen, die Eigenschaft, Dingen anhand ihrer Eigenschaften symbolischen Wert zu geben. Ob das ein Berg ist oder ein Fluss oder ob wir zum Beispiel jemanden Holzkopf nennen. Da übertragen wir unsere Welt quasi Eigenschaften unserer Umwelt auf die metaphorische Ebene. Das machen wir mit allem. Und das machen wir ganz, ganz besonders eben mit den Materialien, die uns ja quasi wie eine zweite Haut umgeben. Also jetzt als Beispiel: Gold hat ja diese ganz spezielle Eigenschaft, dass es nicht anläuft, dass es nicht korrodiert. Und das haben die Menschen vor Jahrtausenden schon festgestellt, dass dieses Material besonders ist. Es verfällt nicht, es korrodiert nicht, es läuft an. Es ist dadurch dann ein Symbol für Ewigkeit. Und dann hat es natürlich auch noch den Vorteil, dass es ungefähr die Farbe der Sonne hat. Und die Sonne ist ja auch göttlich. Also diese Übertragung von Eigenschaften ins Metaphorische ist etwas, was wir Menschen die ganze Zeit tun. Und die Materialien sind eben im Zentrum unserer Welt, unseres Selbstverständnisses. Lars, das finde ich ganz spannend, weil man ja eigentlich bei dem Begriff Material, oder ich habe auch in der Anmoderation von Werkstoffen gesprochen, da ist man erstmal in so einem handwerklichen Ding. Man denkt an Werkzeuge, an gegenständliche Sachen. Aber ich höre so ein bisschen raus, das ist ja eben doch mehr für den Menschen. Argumentiert ihr auch so ein bisschen in der Themenwoche und nachdem ihr euch das so angeschaut habt? Ja, genau. Also ich denke, das liegt ein bisschen daran, dass diese Materialien uns erst zu dem machen, was wir sind. Einerseits, was ich schon erzählt habe, auf der persönlichen, psychologischen, kulturellen und so weiter Seite, aber auch von der evolutionären Seite. Wenn man sich anguckt, was wir als Mensch, wir sind ja mehr oder weniger nackte Affen, die vor 100.000, 200.000 Jahren durch die Savanne oder entlang von Gewässern da rumgerannt sind. Und wir haben keine Krallen, wir haben keine großen Zähne, wir sind nicht irgendwie besonders stark oder so, wir können nicht besonders gut rennen. Und das, was diesen Lebensstil letztendlich möglich gemacht hat, ist mit ziemlicher Sicherheit unsere Fähigkeit, Werkzeuge, Werkstoffe zu benutzen, Feuer zu machen, Dornbusche um eine Lagerstelle aufzuschichten. Das heißt, wir sind da von Anfang an letztendlich in dieser total engen Beziehung mit Materialien drin, die uns zu dem machen, was wir sind. Und da sind wir eben dann heute zum Beispiel auch bei Computer- und Kommunikationstechnologien, die uns dann auf persönlicher Ebene und jetzt auch auf Menschheit wieder auch zu etwas anderem machen als die Menschheit vor dieser Entwicklung von diesen Technologien war. Also das ist total fundamental aus meiner Sicht. Was ich bei der ganzen Sache auch wirklich interessant finde, sind die Beziehungen, die man irgendwie zu Materialien entwickelt. Also ich denke da jetzt an bestimmte Klamotten, wie die sich anfühlen, was das bei einem auslöst, ein bestimmter Stoff oder so. Oder jetzt, keine Ahnung, der alte Holzschreibtisch, den man irgendwo stehen hat, mit dem man irgendwie total was verbindet. Also man interpretiert ja da richtig Gefühle rein. Lars, wie würdest du das Verhältnis von uns jetzt zu Materialien beschreiben? Das ist tatsächlich schon ziemlich intim. Das sehen wir daran, wie du schon sagst, wie viel Wert wir diesen Materialeigenschaften beimessen. Zum Beispiel, wenn man jetzt über Bücher redet: Man kann super praktisch E-Books lesen auf dem E-Reader, das mache ich die ganze Zeit. Aber wir haben eine Riesendiskussion, dass man natürlich Bücher lesen muss, um diese Bücher zu fühlen, um sie zu riechen, um das Papier zu haben, dass ein Buch hochwertiger wird, wenn es besser gebunden ist, bessere Materialien hat, tatsächlich auch ein bisschen unabhängig vom Inhalt. Diese Materialien sind so intim mit uns letztendlich, dass sie uns berühren, dass wir in unserer Bewusstheit, dieses Taktile, das wir da haben, dieses mit allen Sinnen mit diesen Materialien interagieren, das macht diese Materialien natürlich auch sehr emotional. Das macht uns so nostalgisch für alte Holzmöbel, für alte Gerüche, weil es eben mit allen Sinnen sehr intim ist, auf einer sehr persönlichen Ebene. Voll. Und jetzt haben wir, um mal so ein bisschen auch die Brücke in die Moderne vielleicht auch zu schlagen, früher hat der Mensch natürlich logischerweise hauptsächlich mit Naturmaterialien gearbeitet. Inwiefern verändert sich denn so unser Selbstbild und alles, was du jetzt auch so beschrieben hast, wenn wir zunehmend ja auf künstliche Materialien jetzt setzen, wie, keine Ahnung, Plastik zum Beispiel oder auch Silizium oder so? Es ist schon so eine Art von Magie, weil wir als Menschen früher immer noch so ein bisschen von diesen Naturmaterialien eingeschränkt waren oder zumindest auf die Eigenschaft dieser Naturmaterialien achten mussten. Zum Beispiel, wenn man heutzutage mit Holz arbeitet, dann muss man sehr auf die Maserung achten, auf den Typ des Holzes, und das macht eben das Handwerk aus. Und heute erschaffen wir nicht nur Dinge aus Materialien, die wir vorfinden, sondern wir erschaffen auch völlig neue Materialien, die wir als Menschheit auch viel, viel besser fine-tunen können. Das heißt, es erweitert unsere Möglichkeiten noch mal immens. Das muss man sagen, dass das wirklich eine Art von materieller Magie ist, die wir da haben, die in unseren Smartphones ist, die in unserer Kleidung, in unserer Fortbewegung und so weiter. Was natürlich so eine gewisse wahrgenommene Trennung zwischen uns und diesen Materialien hat, dass wir plötzlich irgendwie, ja, das ist utilitaristisch und ja, wir benutzen sie gerne. Aber was du schon gesagt hast, der Holzschreibtisch, Naturmaterialien in ganz strategischen Punkten, gerade wenn es um ästhetische Fragen geht, wenn es um den Gefühlseindruck geht, um den haptischen Eindruck, um dieses mit allen Sinnen wahrnehmen. Wenn wir mit allen Sinnen gemütlich und eins mit der Welt oder so sein wollen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber wenn wir uns wohlfühlen wollen mit allen Sinnen, dann gehen wir immer noch zurück zu diesen Naturmaterialien in ganz vielen Fällen. Und das zeigt doch eben schon, dass wir uns ein bisschen von diesen modernen Materialien entfremdet haben. Noch einen ganz interessanten Punkt fand ich so in der Vorbereitung auch, dass einem fällt es gar nicht so auf, aber wenn man sich da mal mit Materialien beschäftigt, merkt man so, wir haben ja sogar ganze Epochen der Menschheitsgeschichte, die nach bestimmten Materialien benannt sind. Ja, Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit. Lars, wie müsste man denn so unsere heutige Zeit nennen oder vielleicht auch so die letzten Jahrzehnte? Also welche Materialien sind da entscheidend? Man hat ja natürlich verschiedene Materialien zur Auswahl. Man könnte zum Beispiel den Stahl nennen, das ultimative Werkzeugmaterial in allen Fabriken, auch in unserem Alltag, was die Menschheit fundamental verändert hat, einfach durch diese besonderen Eigenschaften des Stahls. Dann natürlich die Kunststoffe. Über die letzten 100, 150 Jahre, durch die wir viel mehr künstliche Materialien, viel mehr Möglichkeiten der verschiedenen Arten von Materialien auch in unserem Alltag gekriegt haben. Denn Stahl ist ein bisschen das Material der Industrie und Kunststoff, wenn wir uns einen Haushalt angucken, ist Kunststoff eigentlich das Material unseres Zuhauses, unseres Alltags. Ähnlich wie Naturtextilien früher, heute ist das alles Kunststoff: vom Computer, Tupper, Töpfe, was auch immer. Alles um uns herum ist Plastik, weil es so unglaublich praktisch ist. Das ist ein sehr guter Kandidat. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor, wenn wir uns das hier und jetzt angucken, das sind wahrscheinlich die Materialien für Computerchips, für Schaltkreise, für Kommunikationstechnologien, Glasfaser zum Beispiel. All diese Hightech-Werkstoffe, die unsere sogenannte digitale oder virtuelle Welt, diese Kommunikation möglich machen, das ist ja alles extrem materialbasiert. Ich weiß jetzt nicht, ob man unser Zeitalter das Halbleiterzeitalter nennen sollte, aber das ist das, was unsere heutige Zeit, unsere Kultur extrem prägt. Und da sieht man eben auch wieder, wie das auf ein neues Material zurückgeht. Ohne diese siliziumbasierten Halbleiter und die damit verbundenen Techniken, dann gäbe es das alles nicht. Ja, total. Also fügen wir an: Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit, vielleicht noch Stahlzeit und vielleicht auch noch Plastikzeit und wahrscheinlich dann auch Silizium- oder Halbleiterzeit. Und Lars, wenn wir jetzt so einen Blick noch mal in die Zukunft werfen, 100 Jahre voraus oder vielleicht sogar mehr, was haben wir denn dann wohl für ein Zeitalter? Oder anders gefragt: Welches Material wird dann für uns entscheidend sein? Das ist natürlich praktisch nicht vorherzusehen, einfach weil es auch so extrem stark von unserer Kultur abhängt, von dem, was wir für wichtig und für sinnvoll halten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ganz, ganz dringend irgendwelche Kolonien auf dem Mars oder auf dem Mond oder so bauen wollen, da braucht man völlig neue Werkstoffe für. Man wird völlig neue Techniken entwickeln müssen, eben völlig neue Materialien, die dann zum Beispiel diesen, ja, Statue könnte man sagen, diesen Weg ins Weltall prägen. Und wenn dieser Weg ins Weltall für uns dann so kulturell prägend ist, dass wir sagen, das ist unsere Zeit, unsere Zeit ist die Zeit des Aufbruchs ins Weltall, na klar, dann sind es die Materialien, die dahinterstehen, die die Welt prägen. Aber das kann man eben nicht vorhersehen, denn der Mensch ändert sich. Die Kultur erzeugt Bedürfnisse, diese Bedürfnisse führen dazu, dass wir neue Materialien entwickeln, die dann wiederum in die andere Richtung unsere Kultur wieder verändern, die Bedürfnisse verändern. Möglicherweise wird das Material der Zukunft auch eher etwas sein, was extreme Nachhaltigkeit und extremes Hightech verbindet, zum Beispiel modifizierte Hölzer oder eben neuartige Kunststoffe, die für die Kreislaufwirtschaft entscheidend sind. Das wäre quasi das, ist ein Thema bei der Themenwoche, dass wir heutige Kunststoffe möglicherweise komplett abräumen, weil wir sie nicht vernünftig recyceln können und stattdessen neue Kunststoffe entwickeln, die sich in so einer Kreislaufwirtschaft führen lassen. Und auch das könnten eigentlich die Materialien der Zukunft sein, wenn wir als Menschen sagen, okay, wir haben Nachhaltigkeit geschaffen. Dieses Material ist das Symbol für das, was wir geschafft haben, für das, was wir in unserer Welt für wichtig erachten. Und deswegen benennen wir uns nach diesem Material. Denn natürlich wäre die Entscheidung, unsere Zeit Stahlzeit zu nennen, auch eine ganz bewusste Fokussierung auf die Industrie, auf den modernen Kapitalismus, den wir als total entscheidend für unsere Kultur heutzutage betrachten und aus schlechten Gründen. Aber deswegen kann man das nicht vorhersagen. Das ist ein Wechselspiel von Mensch, Kultur, Material. Wir werden sehen. Lars, was es dann am Ende wird. Du hast gerade aber noch zwei Sachen angesprochen, auf die ich gerne noch ein bisschen eingehen würde gesondert. Und zwar ist es einmal so eine politische oder verteilerische Komponente, die sicherlich auch in Zukunft vielleicht noch eine größere Rolle spielt, eben wenn wir über seltene Erden reden, über bestimmte Edelmetalle, die wir für Technologie brauchen. Nämlich die Frage nach Macht und Ungleichheit im Zugang zu bestimmten Materialien. Das ist ja sicherlich auch extrem entscheidend. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich in unserem Verhältnis zu Materialien, in unserem Verständnis von Materialien. Dass wir zum Beispiel heute ganz, ganz viel über seltene Erden reden, hat natürlich etwas damit zu tun, dass sie für viele Anwendungen, die wir für unglaublich wichtig erachten, entscheidend sind. Und natürlich fühlen wir uns da auch so ein bisschen erpressbar als Kultur. Wir sind da ja auch erpressbar. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so sehr eine Materialfrage. Das ist eher eine Frage der Rohstoffe. Der Materialteil kommt eher an den Punkt, in dem wir möglicherweise auch, getrieben von diesem kulturellen Bedürfnis, dann Materialien entwickeln, in denen wir diese seltenen, knappen, begrenzten Rohstoffe durch breiter verfügbare Rohstoffe ersetzen. Zum Beispiel, wenn man die seltenen Erden in Magneten auf irgendeine Weise vernünftig durch Eisen- oder Aluminiumverbindungen ersetzen kann, irgendwelche fortschrittlichen Legierungen, die man eben heutzutage noch nicht so richtig hat. Natürlich treibt das dann auch die Materialwissenschaft voran. Oder wir sagen, na ja, wir wollen jetzt aus Rohöl keine Brennstoffe, wir wollen aus Rohöl keine Kunststoffe mehr herstellen. Was machen wir denn dann? Wo kriegen wir den Kohlenstoff her? Möglicherweise ziehen wir den aus der Atmosphäre. Und auch da würde man ganz neue Materialien und ganz neue Technologien brauchen. Also ja, diese Verknappung trägt auf jeden Fall dazu bei, die treibt natürlich auch die Materialentwicklung und die Technologie. Aber ich denke, das ist eher eine Frage der Rohstoffe und nicht so sehr der Werkstoffe selbst. Und ein anderer Punkt, den du gerade noch angesprochen hattest, den ich auch sehr wichtig finde, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also Materialien oder auch was wir aus ihnen machen, ist ja auch was, das von uns bleibt. Erstmal ganz platt gesagt: Wir finden heute noch Schwerter irgendwie aus der Bronzezeit. Und wir wiederum hinterlassen natürlich auch wieder Dinge, die unsere Nachfahren dann finden. Und das ja nicht immer zum Positiven. Also wir hinterlassen ja einiges auf diesem Planeten, was vielleicht unsere Nachfahren lieber nicht da hätten. Da stellt sich auch noch eine Frage nach Verantwortung für Materialien, nachdem sie ihren Zweck vielleicht erfüllt haben. Und die Frage, wer trägt die? Also der Produzent, der Konsument oder wir insgesamt als Gesellschaft? Das mit der Verantwortung für unsere Materialien, da gibt es verschiedene Ebenen. Also auf quasi unserer Alltagsebene, na klar, die Produzenten müssen darauf aufpassen, dass die Materialien sicher sind, dass sie möglicherweise auch recycelt werden können. Und natürlich wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben jetzt die Verantwortung, auch mal drüber nachzudenken, wo wir unsere Materialien in die Umwelt schmeißen und so. Aber das haut nicht mehr so richtig hin, weil wir sind ja nicht mehr in einer Welt, wo wir keine Ahnung, so ein Stück Holz ein Jahr lang benutzt haben, sondern wir kaufen jeden Tag alles Mögliche aus irgendwelchen Materialien und dann benutzen wir es und dann geht es irgendwann relativ schnell kaputt. Dann werfen wir es weg und kaufen das Ganze neu. Wir haben einen viel, viel höheren Durchsatz. Und in dieser Situation kann man das eigentlich gar nicht mehr auf individuelle Verantwortung reduzieren. Ich meine, versuch mal zu leben, ohne Plastikmüll zu produzieren. Funktioniert nicht. Also funktioniert nur extrem schwer und mit enormem Aufwand und auch nur bei manchen Produkten. Und deswegen müssten wir eigentlich jenseits unserer individuellen Verantwortung irgendwie einen Weg finden, als Gesellschaft eine neue Perspektive auf unsere Materialien zu entwickeln. Also ein Verständnis dafür, dass unsere Materialien eben auch ein Leben nach uns haben, dass sie eben nicht weggeworfen sind und dann aus den Augen, aus dem Sinn sind, sondern dass wir das Ganze vom Anfang bis zum Ende denken müssen: von den Rohstoffen, von der Fabrikation, von unserem Umgang damit. Und dann eben Materialien dann so produzieren und so auch verwenden, dass wir dieses Problem mit unserem Plastikabfall, mit dem enormen Rohstoffverbrauch und so weiter nicht mehr haben. Also das heißt, wir brauchen da eine, wiederum bei Materialien, wie bei Materialien ganz oft, eine kulturelle Veränderung, eine Art geistigen Wandel darauf, wie wir unsere Materialien sehen, dass wir dann eben nicht nur die Wegwerf-Plastiktüte sehen, sondern eben das Besondere, das Magische dieser modernen neuen Materialien, das wir heutzutage ein bisschen übersehen. Wir übersehen total, was für großartige Werkstoffe das sind, die wir da erschaffen. Und ja, da sollten wir, glaube ich, eine bessere Beziehung aufbauen, einfach auch in dem Sinne, dass wir nicht mehr so viel wegwerfen, nicht mehr so viel verbrauchen, sondern mehr Wert schätzen. Und Lars, zum Ende unseres Gesprächs würde ich gerne mal noch so ein bisschen mit dir in die Zukunft schauen. Es ist ja so, dass Materialien auch so ein bisschen verändern, wie wir zusammenleben. Und es gibt schon erste Ansätze für Materialien, die zum Beispiel sich dann von selbst verändern, so wie wir das wollen, oder sich selbst reparieren oder teilweise, wenn man das so formulieren kann, selber denken können, in Anführungszeichen. Da muss man sich auch so ein bisschen fragen, wie könnte eine Gesellschaft denn in Zukunft mit solchen Materialien aussehen? Das ist ja heute noch, zumindest für mich, relativ schwer vorstellbar. Das ist auch alles noch ganz am Anfang. Aber natürlich, wenn solche Materialien im großen Stil verfügbar sind – und auch das hängt natürlich wieder von unseren Prioritäten ab – dann würden sie unsere Welt und unser Selbstverständnis noch mal drastisch verändern. Denn selbstheilende, selbstwachsende Materialien mit ganz neuen Fähigkeiten, die würden wir dann ja nicht mehr wegwerfen, sondern wir würden zum Beispiel unsere Werkstoffe, unser Zeug letztendlich viel länger benutzen können. Man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man Baustoffe benutzt, die sich selbst heilen oder die möglicherweise selbst wachsen. Das klingt jetzt ein bisschen wie totale Science-Fiction, selbstwachsender Beton oder so. Aber wenn man in die Natur guckt, natürlich haben wir da Strukturen und Organismen, die selbst wachsen, die quasi ihre eigenen Behausungen erschaffen, ihre Materialien selbst in wachsender Weise nutzen, wie Korallen, wie Bäume, solche Sachen. Und wenn wir unsere Materialien weit genug vorantreiben, möglicherweise wird eine Stadt in Zukunft eher eine Art lebendes Riff sein oder zumindest eine Art Struktur, die sich nach ihren eigenen Gesetzen entwickelt, die wir einmal hinstellen und wo wir dann nachher – das ist der fundamentale Punkt – dann quasi nicht mehr am Tischbrett sitzen und uns überlegen, wie die Welt aussehen soll, wie die Stadt aussehen soll, sondern dass wir ein bisschen die Kontrolle abgeben und diese Materialien, diese Werkstoffe einfach auch ein bisschen mehr machen lassen, wofür wir sie erschaffen haben. Und dann dieses dynamische Materialien eher bewohnen und eher nutzen, als sie permanent umzubauen, wie heute. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Vorstellung. Lars, und ihr alle merkt, glaube ich, schon in dieser Themenwoche, auch wenn der Begriff so ein bisschen sperrig wirkt oder gar das Gegenteil von sperrig eigentlich so ein bisschen allgemein wirkt: Materialien, geht es hier um Sachen und um Fragen, die uns alle alltäglich angehen. Und deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch diese Themenwoche anzuschauen. Auf spektrum.de findet ihr das Ganze mit vielen verschiedenen Artikeln zum Thema. Und Lars, ich würde dich gerne noch fragen, was ist denn dir, die du ja betreut hast, diese Themenwoche so vielleicht besonders hängen geblieben? Gibt es da einen Fakt oder eine Info, wo du sagst, Mensch, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben? Ja, mein persönlicher Lieblingsartikel ist tatsächlich der über das Birkenpech. Das ist ein uraltes Material, das schon die Neandertaler benutzt haben. Das war der erste Klebstoff und das erste Hightech-Material der Menschheit. Und die große Frage war immer: Wie haben die Menschen vor Zehntausenden von Jahren dieses Zeug eigentlich hergestellt? Haben sie das durch Zufall von irgendwelchen Steinen abgekratzt oder nicht? Und tatsächlich haben sie schon damals dieses Material ganz gezielt hergestellt, um es in dieser Weise als Werkstoff zu benutzen. Das zeigt eben, wie fundamental diese Beziehung zwischen Rohstoff, Material, Werkstoff und der Art und Weise ist, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Denn natürlich macht es für uns und unsere Umwelt einen ganz großen Unterschied, ob wir einfach nur ein Holzknüppel haben oder ein Pfeil mit einer Feuersteinspitze. Ja, ganz bestimmt. Und Lars, gib uns mal einen kleinen Überblick: Was erwartet uns denn noch in der Themenwoche? Was kann man noch lesen? Neben diesem schönen Birkenpech-Artikel haben wir einen schönen Text darüber, warum wir unsere Kunststoffe, unser Plastik eigentlich loswerden müssen und welche neuen Kunststoffe sie ersetzen und wie und in welcher Weise das passieren kann. Dann haben wir Beton. Gab ja gerade das Thema eingestürzte Brücken, weil der Stahl im Stahlbeton einfach verrottet ist. Und es gibt aber eine Möglichkeit, von diesem Stahl wegzukommen, und zwar mit Hilfe von Kohlefasern, die eben nicht so korrosionsanfällig sind. Darüber ist ein Artikel. Dann die schon genannten selbstheilenden Materialien. Und wir haben einen schönen Artikel, was man mit Holz alles machen kann, wie man Holz verändern kann, wie man Holz sinnvoller nutzen kann, wie man Holz, diesen Naturstoff, als echtes Hightech-Material wie unsere Kunststoffe verwenden kann. Und zum Schluss, weil man heutzutage nicht ohne künstliche Intelligenz auskommt, natürlich noch ein Artikel über KI in der Erforschung neuer Materialien. Also ein sehr, sehr breites Spektrum, das ihr da, wie der Name schon sagt, bei Spektrum der Wissenschaft wieder abdeckt in dieser Themenwoche zum Thema Materialien und Werkstoffe. Und Lars, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, den du uns gewährt hast und dieses, ja, ich fand wirklich sehr interessante Gespräch über die Beziehung zwischen Mensch und Material. Danke dir! Ja, und das war’s von uns für diese Woche vom Spektrum-Podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Seid doch gern auch kommende Woche wieder dabei. Wie immer am Freitag gibt’s dann eine neue Folge von uns. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und teilt. Das hilft uns immer sehr. Auch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Mein Name ist Max Zimmer und ich sag Tschüss und macht’s gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von detektor.fm. Untertitel von Stephanie Geiges.
 Foto: Spektrum der Wissenschaft
Foto: Spektrum der Wissenschaft