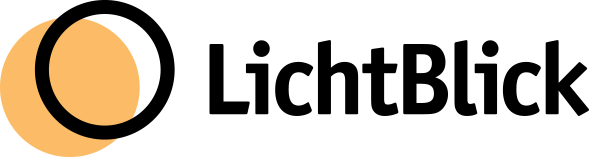Bevor es losgeht, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Gemeinsam mit Spektrum der Wissenschaft haben wir einen neuen Podcast gestartet. Die großen Fragen der Wissenschaft heißt er, und der Name ist Programm. Die Hosts Katharina Menne und Carsten Königer von Spektrum stellen die großen Fragen der Wissenschaft, also zum Beispiel: Was lauert in der Tiefsee? Und das ist tatsächlich eine sehr große Frage der Wissenschaft, denn in der Tiefsee liegt der tiefste Punkt der Erde. Der Druck ist enorm, und ab etwa 1000 Metern herrscht völlige Dunkelheit. Und weil die Tiefsee so unzugänglich ist, wissen wir heute mehr über die Rückseite des Mondes als über den Grund unserer Meere. Und genau deshalb ist das auch eine der Fragen, die wir in der ersten Folge mit der weltweit führenden Expertin für Meeresbiologie Antje Boetius besprochen haben. Weiter geht es im Oktober mit der Frage: Hat der Mensch einen freien Willen? Hört doch gerne einmal rein und folgt dem Podcast Die großen Fragen der Wissenschaft in eurer Lieblings-Podcast- App. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Die Baubranche ist weltweit für rund 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, verzeichnet die größten Güterbewegungen und den größten Ressourcenverbrauch. Um Klimaschutzziele einzuhalten, muss also an vielen Ecken geschraubt werden. So hat die Regierung beispielsweise das Ziel gesetzt, dass der Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral sein soll. Wie realistisch ist das und was bedeutet es, klimafreundlich und vor allem nachhaltig zu bauen? Das wollen wir diese Woche hier im Klima-Podcast von detektor.fm klären. Mein Name ist Ina Lebetjew. Schön, dass ihr da seid. Hi! Mission Energiewende. Der detektor.fm-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100 Prozent Ökostrom. Ob beim privaten Hausbau oder in der Industrie: Wer nachhaltig baut, kann einen wichtigen Teil zum Klimaschutz beitragen. Worauf muss man dabei achten und wie präsent ist das Thema nachhaltig bauen in Deutschland? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina! Hallo Ina! Wir wollen uns heute mit Nachhaltigkeit in der Baubranche beschäftigen. Was bedeutet es überhaupt, nachhaltig zu bauen? Ja, ich glaube, als erstes denkt man da vor allem an Materialien auswählen. Also, was braucht man? Wo kann man recyceln oder bereits existierende Gegenstände und Materialien wiederverwenden und so weiter? Das ist auch alles wichtig, aber ein Großteil der Arbeit fängt davor an, nämlich in der Planung. Da geht es dann um Fragen wie zum Beispiel: Welcher Standort ist besonders geeignet? Wie ist die Umgebung? Auf welche Werte möchte ich achten, wenn es zum Beispiel um Herstellungs- und Produktionsketten geht? Nachhaltiges Bauen bedeutet erstmal, sich sehr, sehr, sehr früh im Prozess des Bauens damit zu beschäftigen, was eben die Bedarfe sind, um darauf zugeschnittene Lösungen nach und nach zu suchen und diese Definition erstmal vorzunehmen. Das sagt Tore Waldhausen. Er ist Gründer des Startups Relief, das sich auf klimaangepasste Sanierungen konzentriert. Außerdem ist Waldhausen des regionalen Bündnisses Leipzig von Architects for Future, das 2019 gegründet wurde. Ihm zufolge ist es wichtig, so früh wie möglich entsprechende Stakeholder mit einzubinden, Know-how abzugreifen und entsprechende Konzepte zu erarbeiten. Jetzt hast du ja eben Recycling mit angesprochen. Das ist ja am Ende trotzdem ein erneuter Energieaufwand. Wie lässt sich das mit dem Konzept nachhaltig bauen vereinbaren? Insgesamt geht es ja darum, dass so viele Materialien oder Produkte wie möglich am Ende ihres Lebenszyklus nicht auf dem Müll landen. Waldhausen zufolge ist es deshalb wichtig, direkt beim Produktdesign über Recycling nachzudenken, sodass das Produkt theoretisch in einem Kreislauf kursieren kann. Aktuell ist es oft aber noch so, dass das nicht passiert und dementsprechend das Material irgendwann beim ständigen Recycling verbraucht ist und das Produkt am Ende doch weggeschmissen wird. Da sieht er also großes Potenzial. Wichtig ist aber auch, dass recycelte Produkte dieselben gesetzlichen Anforderungen erfüllen wie das Ursprungsprodukt. Das kann manchmal auch eine Hürde im Recycling sein, da sich die Normen und Standards vielleicht geändert haben. Nun haben wir uns bei detektor.fm vor sechs Jahren schon einmal mit dem Thema beschäftigt und hier bei Mission Energiewende darüber gesprochen, ob Deutschland nachhaltig baut. Die Folge dazu verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Kannst du uns dazu kurz einen Recap geben und wie ist da der aktuelle Stand? Also 2019 konnte man nachhaltig bauen fast schon als Nischenthema bezeichnen. Das Thema ist hierzulande nicht wirklich präsent gewesen und dementsprechend hat es auch nicht so viele deutsche Unternehmen gegeben, die sich aktiv damit beschäftigt haben. Das ist mittlerweile anders, so Tore Waldhausen. Es hat sich stark verändert über die letzten Jahre, erstmal auch sehr zum Positiven. Ich würde schon sagen, dass durch den medialen Druck, gerade von den Fridays for Future, wo wir auch als Architects for Future an verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten mit teilnehmen konnten, hat man schon gemerkt, dass das Thema sich viel mehr auch in die Politik hinein gräbt und wir wieder auch mitgestalten konnten. Dennoch muss er zugeben, dass das Thema zuletzt auch wieder etwas in den Hintergrund gerückt ist. Das liegt vor allem an den politischen und auch anderen Krisen, mit denen das Land konfrontiert gewesen ist. Und das ist ein Problem, natürlich auch allein aufgrund dieser Abstraktheit, dass eben Klimaveränderungen, die sich über Jahre, Jahrzehnte verändern, nicht so eine Relevanz in den menschlichen Köpfen haben wie einen Ukrainekrieg oder eine Wirtschaftskrise etc. Ist es auch mit Zahlen oder anderen Daten belegbar? Zahlen nicht konkret, aber es gibt Entwicklungen, die das Gefühl unterstreichen. So ist vor ein paar Jahren die EU-Taxonomie beschlossen worden. Das ist eine Art Definition beziehungsweise Maßstab von Nachhaltigkeit für Unternehmen und Investoren. Da klingelt es bei mir im Kopf, muss ich sagen. Also, was genau EU-Taxonomie bedeutet und wie das geplant war, was das beinhaltet, das haben wir damals, als das aktuell diskutiert wurde, auch in einem Podcast erklärt. Knowledge for Future heißt der, und wir verlinken euch die Folge in den Show Notes, damit ihr euch da noch mal genauer informieren könnt. Genau richtig, und hier als kurze Zusammenfassung: Der Finanzmarkt hat also Anreize gesetzt, dass Firmen nachhaltiger werden und verschiedene europäische Anforderungen zu Nachhaltigkeit berücksichtigen. Ab diesem Jahr sollte das Ganze dann auch mit Reportings überprüft werden. Das wurde allerdings aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen gekippt. Und es ist nicht nur dieser Rückhalt nicht mehr da, sondern es ist auch eine große Unsicherheit. Ja, wie geht denn das jetzt weiter? Wenn es einmal gekippt wird, wird es nochmal gekippt? Wann muss ich jetzt reportingpflichtig werden? Dann wird diese ganze Reportingpflicht doch mehr als Druck von oben wahrgenommen als Unterstützung für Unternehmen, sich wirklich mit den Risiken und mit der Nachhaltigkeit zukünftig auseinanderzusetzen, was für viele Unternehmen wahrscheinlich sinnvoll wäre. Sie würden es einfach tun, um diese Aspekte auf dem Schirm zu haben. Das führt dann natürlich auch dazu, dass sich weniger Unternehmen mit dem Thema beschäftigen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Ihr wollt 100 Prozent Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach. Wenn wir einmal auf der politischen Ebene sind: Ich habe am Anfang gesagt, dass die Bundesregierung angesetzt hat, dass bis 2045 der Gebäudebestand klimaneutral sein soll. Wie sieht es da aktuell aus? Richtig, also die Politik hat nachhaltiges Bauen schon auf dem Schirm, und da geht es eben auch nicht nur um Klimaneutralität, sondern auch darum, den Flächenverbrauch zu reduzieren, Produkte und Dienstleistungen nachhaltig zu beschaffen und auch Menschenrechte in der Lieferkette einzuhalten. Dafür gibt es auch ein eigenes Qualitätssiegel, eine Ökobilanzdatenbank und ein spezielles Bewertungssystem. Viele Bau- und Immobilienfirmen stufen das Ziel der Klimaneutralität jedoch als sehr schwierig ein, so Tore Waldhausen. Ein Wandel innerhalb der Branche braucht es dennoch. Ich würde aber tatsächlich auch sagen: Lass uns mal über das Ziel wirklich nochmal nachdenken, denn Klimaneutralität für mich ist irgendwie keine coole Vision. Ich würde es irgendwie anders nennen. Ich würde es irgendwie sagen: Nennst du es Klimapositivität oder Bauen mit positivem Fußabdruck oder was auch immer. Aber wir haben ja die Möglichkeit, Energie beispielsweise erneuerbar herzustellen. Wir haben auch die Möglichkeit, dass Materialien regenerativ sind, dass Baukonzepte regenerativ sind. Also lass uns doch eher überlegen, wie können wir regenerativ bauen, um zu gucken, wie wir positiv einwirken können. Und dann ist es gleich ein viel schönerer Anreiz, den man natürlich auch noch definieren müsste. Hat er denn da konkrete Ideen? Also, wo sind derzeit die größten Einsparpotenziale? Natürlich kann man beim Neubau auf all die Aspekte achten, die wir am Anfang genannt haben. Er sieht aber tatsächlich das größte Potenzial in der Sanierung. Für Deutschland sagen wir: Architects for Future, immer Deutschland ist gebaut. Also letztlich haben wir so viel Baustruktur und so viele Gebäude und so viele Flächen geschaffen, dass wir davon ausgehen können, wenn wir sie einfach nur sinnvoll nutzen und gut verteilen, dann können wir mit diesen Flächen sehr gut leben. Was nicht heißt, dass alle Gebäude gut gebaut sind. Natürlich müssen wir sanieren, wir müssen umplanen etc. Aber ich glaube, die wichtigste Message wäre schon, wenn wir einfach sagen: Wir bauen nicht mehr neu, wir sanieren oder wir hinterfragen Abriss sehr, sehr kritisch und gucken, dass wir so viel wie möglich einfach sanieren. Das ist der wichtigste Hebel, den wir haben. Großes Einsparpotenzial sieht er außerdem in der Energie. Denn ein Großteil der Energie, die im Bauprozess aufgebracht wird, steckt in den Materialien. Wenn also vorhandene Materialien und Gebäude genutzt werden, in welcher Art auch immer, spart das eine Menge Energie und damit natürlich auch CO2. Worauf sollte man denn bei der Sanierung überhaupt achten? Das Problem ist, wenn man mit bestehendem Material arbeitet, dass das vielleicht zu ganz anderen Standards gebaut wurde und sich zum Beispiel Aspekte wie die Energieeffizienz Standards geändert haben. Also ähnlich wie ich das vorhin beim Recycling angesprochen habe. Laut Tore Waldhausen muss also besonders über die Gebäudestruktur nachgedacht werden, vor allem wenn es um Fragen zur Dämmung geht. Ein besonders wichtiger Aspekt ist für ihn aber nicht nur Klimaschutz, sondern eben auch Klimaanpassung. Das heißt, die Gebäude, über die wir uns unterhalten, sind für das 20. Jahrhundert gebaut und sind aber eben nicht gerüstet für das 21. Jahrhundert, weil wir Klimaveränderungen jetzt schon haben und die werden kommen, ob wir wollen oder nicht, aber sie werden kommen. Und dafür ist unsere Gebäudestruktur nicht gerüstet. Das betrifft natürlich nicht nur große Unternehmen, sondern am Ende ja auch jede Person, die privat saniert. In einem Beispiel kann man das immer ganz gut nennen, dass wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie ich ein Dach zu sanieren habe, dann kann ich es für den winterlichen Wärmeschutz gut ausstatten, was aber nicht unbedingt auch heißt, dass es für den sommerlichen Hitzeschutz gut geeignet ist. Sondern da muss ich dann auch hier über die Materialwahl oder auch über die Gebäudestruktur nochmal extra nachdenken. Und diesen Zusatzaufwand sollten wir uns unbedingt machen, um nicht in zehn Jahren wieder anpacken zu müssen, das Gebäude, weil es auf einmal stark überhitzt, sondern weil wir das dann eben auch schon mit prognostizieren können, um diese Aspekte mit einzubinden. Diese Recap-Folgen, die wir hier im Klimapodcast diesen Monat machen, da schauen wir ja auf alte Folgen zurück und schauen, wie sich das Thema gewandelt hat und wie wir es heute diskutieren können. Mir ist aus der Episode von vor ein paar Jahren ein Gedanke hängen geblieben, nämlich dass es natürlich auch auf die Ausbildung ankommt, dass BauingenieurInnen und ArchitektInnen das Thema für sich selbst eben begreifen und anpassen müssen, damit sie damit arbeiten können. Was nimmst du denn aus deiner Recherche für einen Gedanken mit zum Thema nachhaltiges Bauen? Also fairerweise steht das Bauen jetzt nicht direkt auf meiner Planungsliste ganz oben, aber ich fand den Aspekt mit der Sanierung und vor allem mit der Klimaanpassung besonders spannend. Also, dass man halt sowohl beim Bauen als auch beim Sanieren da halt mit drauf achtet. Das ist ja auch der Punkt, wenn es um Städte geht und so was, dass das halt alles angepasst werden muss ans Klima. Und dass das auch beim Bauen mit einer Rolle spielt, wenn man sagt, man baut neu, dass man direkt so baut, dass das auch in 10, 20 Jahren immer noch fürs Klima passt, fand ich tatsächlich besonders spannend. Ja, sehr, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Was bedeutet es nachhaltig zu bauen und wie hat sich Deutschlands Baubranche diesbezüglich in den vergangenen Jahren entwickelt? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Tore Waldhausen gesprochen. Er ist Gründer des Startups Relief, das sich mit klimaangepassten Sanierungen beschäftigt. Außerdem ist er regionaler Sprecher von Architects for Future. Ich danke dir für das Gespräch und für die Recherche, Alina. Genau, das war der Klima-Podcast von detektor.fm für diese Woche. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert Mission Energiewende gerne auf der Plattform eurer Wahl und empfiehlt uns weiter. Das hilft uns wirklich sehr und wir danken euch sehr dafür. Die Produktion für diese Folge hatte Wiebke Stark. Vielen Dank dafür. Und die Redaktion lag bei mir. Ich bin Ina Lebetjew und ich sage Ciao und bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Macht’s gut! Tschüss! Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.
 Foto: Sarah Seiler
Foto: Sarah Seiler